Literarisches Reisen in den Philippinen

Vorbemerkung
Jede Reportage ist mehr als ein Text – sie ist das Resultat zahlreicher Stunden des Zuhörens, Beobachtens und Verweilens. Sie entsteht aus Gesprächen, aus Eindrücken, die zwischen Straßenlärm, Pausen und Schweigen Gestalt annehmen. Doch der fertige Text ist immer nur ein Ausschnitt, ein Kondensat dieser Erfahrung, ein Versuch, aus der Überfülle der Wirklichkeit eine erzählbare Form zu destillieren. Was bleibt, ist stets weniger, als es war. Um dieser Begrenzung zu entkommen, habe ich mich bei dieser Reportage für einen anderen Weg entschieden: Alle Gespräche, die ihr zugrunde liegen, sind auch als vollständige Podcasts abrufbar. Sie können unabhängig vom Text gehört werden, in ihrer eigenen Chronologie und Stimme. So lässt sich das Erzählte erweitern, vertiefen, überprüfen – am rechten Seitenrand dieses Textes oder auf unserer Podcast-Übersichtsseite.
Ein glückliches Mädchen
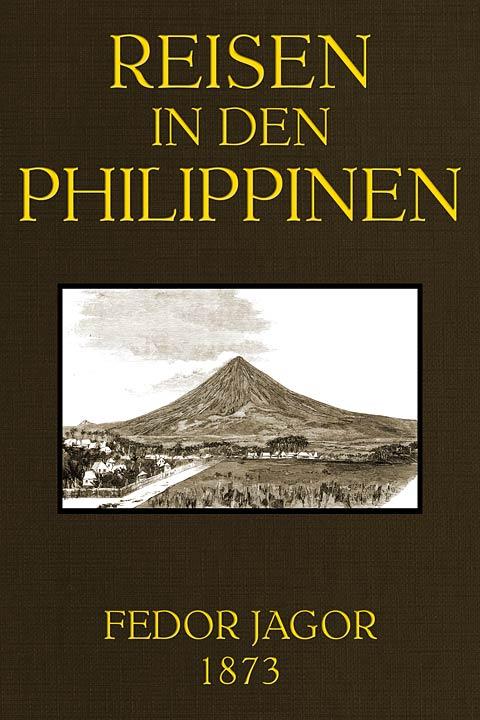 Projekt Gutenberg
Projekt GutenbergFedor Jagor | Reisen in den Philippinen | Projekt Gutenberg
Wer heutzutage Fedor Jagors 1873 auf Deutsch erschienenen ethnografischen Bericht Reisen in den Philippinen liest, dürfte vor allem verblüfft sein. Denn obgleich Jagor im Duktus der damaligen Zeit die „Eingeborenen“ immer wieder als „sittenlos“ bezeichnet – wenn es etwa um ihre „liederliche“ Moral geht, die sich u. a. darin ausdrückt, ohne Arbeit bei Hahnenkämpfen Geld zu gewinnen –, begegnet er auf seiner in den Jahren 1859 bis 1860 unternommenen Reise von Manila nach Bikol auch den spanischen Kolonialherren durchaus kritisch. Er erkennt etwa die von Machiavelli so schön in Worte und von jedweden Kolonialisten gnadenlos implementierte Strategie des „Divide et impera“ (Teile und herrsche), von den Spaniern vor allem über die Sprache geschickt umgesetzt: Spanisch wird selektiv nur jenen gelehrt, die dem spanischen Machtapparat nützlich erscheinen – ein Apparat, der von Jagor fast schon salopp auch bezüglich seiner korrupten Strukturen nicht die allerbesten Noten erhält. Aber was soll man machen, wenn man sich schon damals gegen die aggressive Einflussnahme von Ländern wie China und Russland zur Wehr setzen musste? Da müssen wenigstens die regionalen Machtstrukturen fehlerfrei funktionieren.
Das verblüfft vor allem, weil es sich so vertraut und gegenwärtig anhört. Denn reist man heute auf Jagors Spuren durch die Philippinen, wird man einige seiner Beobachtungen weiterhin teilen können. Und vielleicht hätte Jagor ja sogar seine Meinung bezüglich der „Eingeborenen“ etwas relativiert, hätte er den literarischen (und revolutionären) Übervater der Philippinen, José Rizal, als Kind auf den Philippinen oder als erwachsenen Mann während dessen Studienaufenthalts in Deutschland getroffen. Denn so wie damals weiß auch heute die Literatur eines Landes meist mehr über ein Land als das Land selbst; an dem, was Schriftsteller:innen schreiben, erkennt man sehr oft den Status quo einer Gesellschaft und nicht selten auch ihre Zukunft. Weshalb Jagor heutzutage nach seiner Landung in Manila sich wohl kaum vom spanischen Staatsapparat und seiner ethnografischen Arithmetik hätte trösten lassen, sondern – so wie ich – direkt vom Flughafen losgezogen wäre, um Bebang Siy an ihrem Arbeitsplatz auf dem beeindruckenden Gelände des Cultural Center of the Philippines zu besuchen, das mit seiner markanten brutalistischen Architektur eine erstaunlich harmonische Symbiose mit der Bucht von Manila eingeht.
Schreiben, um etwas zu verändern – Ein Podcast mit Bebang Siy

Ihr Großraumbüro in einem kleinen Nebengebäude sieht nicht anders aus als die meisten Büros dieser Welt, und auch Siys organisatorische Arbeit für staatlich geförderte Kulturveranstaltungen klingt vertraut. Wir ziehen uns mit zwei Kolleg:innen in das ruhige Archiv zurück, und Siy erzählt von ihrem ungewöhnlichen Coming-of-Age als Schriftstellerin. Ungewöhnlich ist es deshalb, weil Siy in einer dysfunktionalen Familie im früheren Rotlichtviertel Manilas, Ermita, groß geworden ist. Aber sie hatte auch ungewöhnlich viel Glück, wie sie mehrmals betont – nicht nur als Kind und Jugendliche, sondern dann auch an der Uni, wo ihr Professor ihr erlaubte, statt einer „normalen“ Abschlussarbeit die essayistischen, kurzgeschichtenartigen Erinnerungen an ihre Kindheit einzureichen, und sie nach der Abgabe ermutigte, das Manuskript einem Verlag zu schicken, da die Alltagsvignetten unbedingt druckreif seien. Und auch das war wiederum ungewöhnlich, denn bis dahin gab es eigentlich nur Bob Ong, einen unter diesem Pseudonym schreibenden Autor, der nicht nur den philippinischen Alltag ins Zentrum stellte, sondern – wie Siy – auch noch auf Filipino schrieb. Das ist trotz des großen staatlichen Projekts, Filipino ähnlich wie Kiswahili in Tansania oder Bahasa in Indonesien als identitätsstiftende indigene Verkehrs- und Nationalsprache zu etablieren, bis heute ungewöhnlich. Auch wenn diese Literatur – so wie Siys It’s a Mens World – Erfolg und universalen Charakter hat, wie man an der auf Literatur.Review veröffentlichten Erzählung Milk Shakes und Daddys aus It’s a Mens World sehen kann. Und weil sie selbst gespürt hat, wie das eigene Schreiben ihr Leben verändert hat, unterstützt Siy Schriftstellerinnen, wo sie nur kann – ihre Liste von Autorinnen, die sie im Laufe der letzten Monate zusammengestellt hat, spricht Bände.

Von ihrem Arbeitsplatz ist es nicht weit zum Yachthafen, wo sich bei Sonnenuntergang Paare vor einer Kulisse fotografieren lassen, die vergessen lässt, dass nur ein paar hundert Meter weiter zwischen modernen Hochhäusern wabenartige Slums liegen, auf die Siy aufmerksam macht. Und während wir im Dunkeln durch ein gentrifiziertes Ermita, ihre alte Heimat, schlendern, wird mir immer verständlicher, dass seit der Revolution Ende des 19. Jahrhunderts und der amerikanischen sowie japanischen Besetzung nicht nur über die Sprache koloniale Strukturen reproduziert werden, sondern auch über die mehr als 200 Familien, politische Dynastien, die das Land unter sich aufgeteilt haben und von denen etwa die Literaturwissenschaftlerin Caroline Hau in ihrem Roman Tiempo Muerto erzählt. Gerade deshalb, betont Siy, brauchen wir eine Literatur, die uns wütend macht – eine, die diese Verhältnisse, die Interaktion von Korruption und Nepotismus, gnadenlos aufdeckt.
Über die Zukunft entscheiden wir
Science Fiction aus Manila – Podcast mit Katrina F. Olan

Davon erzählt am nächsten Tag im hippen Latitude Bean+Bar bei Matcha Latte und vietnamesischem Eiskaffee auch die junge Autorin Katrina F. Olan, die vor Jahren mit ihrem Science-Fiction-Roman Tablay einen Bestseller geschrieben hat, den sie inzwischen auch in einen Comic überführt hat. Zwar, erklärt sie, mag Marcos Junior, der Sohn des auch in Europa bekannten Diktators der Philippinen, bei den letzten Präsidentschaftswahlen 2022 an die Macht gewählt worden sein. Doch die Gen Z hat bei den letzten Kommunalwahlen gezeigt, dass es auch anders geht und zahlreiche einschlägige Familien von ihren Posten abgewählt. Ihr Roman, den sie unter Dutertes Zeiten geschrieben hat, ist – wie so viele Science-Fiction-Romane – auch ein politischer Kommentar. Olans Vermischung traditioneller philippinischer Mythologie und Märchengestalten mit gegenwärtigen Science-Fiction-Elementen zeigt vor allem ein Manila der Zukunft, in dem politischer Revisionismus, Landraub und die Verdrängung indigener Kulturen mit einer radikal komponierten, auf indigenen Wurzeln basierenden Strategie beantwortet werden. Olan erklärt, dass die philippinische Literatur viel zu wenig selbstbewusst sei, viel zu selten in ihrem Schreiben an die weite Welt denke. Dabei habe sie das Zeug dazu – man sehe nur die erstaunliche Comic-Grassroot-Bewegung in Manila oder das einzigartige Bewusstsein der Filipinos für Familie, die auch Nicht-Blutsverwandte inkludiert und für die es schon vor der Kolonialzeit Rituale wie das Bayanihan gegeben habe. Für Olan, die auch sehr erfolgreich für eine Marketing-Agentur arbeitet und die Ideen der Blue Ocean Strategy sowohl literarisch als auch in ihrer Erwerbsarbeit umsetzt, sind Roboter, Romanzen und Rache mehr als nur Motive – sie sind Teil einer Zukunft, die selbstbestimmt in der Gegenwart entschieden wird: Über die Zukunft entscheiden wir!
Liebe, Verantwortung und Hoffnung – Ein Podcast mit Angeli E. Dumatol

Über Selbstbestimmung schreibt auch die Young-Adult- und Romance-Autorin Angela E. Dumatol, die mir nach dem Gespräch mit Olan gegenübersitzt. Doch weniger als die Möglichkeit einer selbstbestimmten Zukunft interessiert sie in ihrem Schreiben eine selbstbestimmte Gegenwart, die vor allem eines zeigt: Bei aller Mühsal, die die gegenwärtigen Philippinen für das Leben normaler Menschen bereithalten, darf die Möglichkeit von Glück nicht außer Acht gelassen werden. Dieses Glück formuliert sie in ihren Büchern für Jugendliche und junge Erwachsene über traditionelle Liebesgeschichten. Sie ist zwar Teil einer Gruppe von Autor:innen und Leser:innen, die über genderfluide Themen diskutieren, definiert sich selbst jedoch als cisgender – und so seien auch ihre Romane. Als Ärztin für Nuklearmedizin lasse sie zudem ihre beruflichen Erfahrungen einfließen, etwa in der Geschichte First Cut der Anthologie The Doctor is in Love, in der es zunächst um berufliche Konkurrenz und letztlich um die Entscheidung geht, was wichtiger im Leben ist: die Liebe oder die Karriere. Über ihre Literatur will sie aber nicht nur die Hoffnung auf ein Happy End vermitteln, sondern auch deutlich machen, dass alle Verantwortung tragen müssen. Und dafür seien die Philippinen gut aufgestellt – sie seien, wie schon Olan betont hatte, eine ungewöhnlich familiäre Gesellschaft.
Ich war nie besonders gesellig
Zwischen Kolumne und Kolonialmentalität – Ein Podcast mit Jessica Zafra

Dass diese familiäre Gesellschaft auch ihre Tücken hat, davon erzählt die mit ihren „Twisted“-Kolumnen berühmt gewordene Autorin Jessica Zafra in ihrem so klugen wie bösen Debütroman The Age of Umbrage. Ich treffe Zafra vor einem der großen Buchkaufhäuser Manilas, dem Fully Booked in Bonifacio Global City. Vom Latitude Bean+Bar dauert es eine halbe Stunde mit dem Motorroller an dieses andere Ende der Metropole. Hat man den alten Teil Manilas mit seinen den Atem der Zeit inhalierenden Gebäuden und Straßen hinter sich gelassen und rast durch diese gewaltige Megacity, scheint es allerdings nicht nur eine halbe Stunde, sondern Welten zu sein, die man in ihrer architektonischen Diversität und in ihren Arm-und-Reich-Hierarchien kreuzt, um am Ende auf einem Planeten zu landen, der moderner (und reicher) nicht sein könnte – mit Bürgersteigen und Flaniermeilen und Sicherheitskräften, die einen nett, aber bestimmt darauf hinweisen, wenn man seinen Motorroller falsch geparkt hat. Wir setzen uns in ein Café, in dem es schon im August Weihnachtsgebäckspezialitäten gibt, was auf den Philippinen nicht sonderlich überrascht: Selbst auf den großen Nachtfähren, die die Inseln verbinden, trifft man in den riesigen Schlafsälen schon im August Menschen, die begeistert davon erzählen, endlich ihren Weihnachtsbaum zu kaufen. Zafra, die in einem Rucksack unter dem Tisch Katzenfutter mit sich führt, um nach unserem Treffen die herrenlosen Katzen des Stadtteils zu versorgen, erklärt, warum es ausgerechnet die Zeit unter Marcos für ihren Roman sein musste. Einerseits sei sie ein „Martial-Law-Baby“, andererseits lasse sich über die Coming-of-Age-Geschichte ihrer jungen Heldin einfach allzu gut die Misere der philippinischen Gegenwart aufzeigen. Wie ihre Figur sei auch sie selbst als junges Mädchen nicht sonderlich gesellig gewesen. Das habe allerdings den Vorteil, die Welt ein wenig härter zu sezieren, als es vielleicht andere tun. Es habe sich seit Marcos natürlich einiges getan – so habe sich etwa die Mittelklasse selbst ermächtigt. Aber weil die Filmindustrie nicht mehr so gut laufe, gingen immer mehr Sternchen aus der Filmwelt in die Politik und würden Senator:innen – und das sei wiederum einfach nur schrecklich. Wie schon in ihrem literarischen Debüt oder dem Diaspora-Märchen Die Abenteurerin auf Literatur.Review wirft sie auch in ihrem neuen, noch nicht erschienenen Roman einen Blick auf den Traum von der Diaspora. Allerdings einen, der weit zurückliegt und von dem die wenigsten wissen: die Reisen und Studienaufenthalte von Rizal und seinen Freunden im 19. Jahrhundert, ein wichtiger Grundstein von allem, was in der Folge politisch und literarisch auf den Philippinen passierte. Dass das Land trotz aller Revolutionen weiterhin sprachlich geteilt ist, ist Zafra schmerzlich bewusst. Bitter lachend sagt sie, dass ja auch ein Großteil der Autor:innen, die im Rahmen der Frankfurter Buchmesse in diesem Jahr als Ehrengäste eingeladen seien, auf Englisch schreiben. Und sie sei auch nur ein weiteres Beispiel für diese Tatsache. Als sie vor einiger Zeit Allan Derains Aswanglaut gelesen habe, habe sie immer wieder Verständnisschwierigkeiten bei Derains auf Filipino geschriebenem Roman gehabt.
Einsprachigkeit ist eine Schande
Mythen, Sprache und Zukunft – Ein Podcast mit Allan Derain

Es regnet schwer, als ich mich am nächsten Morgen in viel zu kleiner Regenkleidung auf meinen Motorroller setze, um Allan Derain zu treffen. Er unterrichtet Kreatives Schreiben und Filipino an der Ateneo-Universität, an der auch schon José Rizal studiert hat. Der Regen, die verstopften Straßen und eine überaus tückische Baustelle kurz vor der Universität machen fast alle Hoffnungen auf ein pünktliches Ankommen am Campus in Katipunan zunichte, doch mit ein paar gebrochenen Verkehrsregeln schaffe ich es dann doch, kurz nach acht in einem Konferenzraum Derain meine Fragen stellen zu können. Mich interessiert vor allem das Coming-of-Age seiner einzigartigen Literatur, die auf Literatur.Review über die Erzählung Tungkong Langit + Alunsina nachzulesen ist. Sein ethnohistorischer Ansatz sei ihm während des Studiums durch die Lektüre von Barangay: Sixteenth-Century Philippine Culture and Society von William Henry Scott vermittelt worden. Heute, betont Derain, sei es in Zeiten des Klimawandels umso wichtiger, Gesellschaften zu re-imaginieren, die noch im Einklang mit der Natur stehen. Und auch die Komplexität alter Mythen wie des Aswang-Mythos – ein Halbgott, der aus zahlreichen Entitäten besteht – sei so etwas wie eine Blaupause für unsere Zukunft. Ich muss an Olans Tablay denken, die auf ganz andere Weise die alten Mythen reaktiviert und in eine positive, wenn auch fiktionale Zukunft überführt. Die Realität, erklärt Derain, sei allerdings nicht ganz so positiv: Die alten Mythen seien mit dem Christentum und dem Bau von Straßen mehr und mehr verschwunden, denn ein Halbgott wie der Aswang braucht Wald – und der wird zunehmend gerodet. Und dann sterben auch die Überbringer:innen der alten Mythen selbst aus: Babaylans, Heiler:innen und Schaman:innen, und die Sänger:innen der alten Epen, die Derain interviewt, um ihr Wissen zu sichern.
Zwar gibt es Studenten, die ich im Vorfeld getroffen habe, die einen Roman wie Aswanglaut unter die Top Ten gegenwärtiger philippinischer Literatur wählen würden, doch Derain mache sich diesbezüglich keine Illusionen. Die Studierenden an der Ateneo, die meist aus urbanen, wohlbehüteten und englischsprachigen Verhältnissen stammen, nähmen die Filipino-Kurse als das hin, was sie sind: eine leidige Pflichtveranstaltung. Dass Einsprachigkeit eine Schande und Mehrsprachigkeit eine Chance ist, ist nur schwer zu vermitteln.
Jenseits der Fluten von Manila
Um neun Uhr, als Derains erste Lehrveranstaltungen beginnen, bin ich wieder auf dem Weg in die Innenstadt, um Chuckberry Pascual in einem Café in Malate, im „alten“ Manila, zu treffen. Doch der Regen wird immer stärker, sodass die Straßenschluchten Manilas mehr und mehr der Stadtdystopie in Ridley Scotts Blade Runner gleichen. Und irgendwann geht nichts mehr: Alle Straßen sind so stark überflutet, dass ich meinen Motorroller abstellen und durch knietiefes Wasser waten muss. Ein paar Wochen später, im September, werden 130.000 Demonstrierende in Manila gegen diese Zustände protestieren – denn dass das Hochwasserschutzsystem faktisch nicht existiert, liegt vor allem an Korruption und Misswirtschaft. Auch Pascual machen die Überflutungen einen Strich durch die Rechnung, und wir verschieben unser Treffen auf den nächsten Tag.
Immerhin fährt die Metro – und das sogar kostenlos. Damit entschuldigt die Stadt sich auf ihre Weise für die Misere, erklärt mir Bebang Siy lachend. Wir fahren nach Cavite, wo sie mit ihrem Freund, dem Filmemacher und Verleger Ronald Verzo, wohnt. Jenseits der Fluten von Manila fühlt es sich in Cavite, der Stadt, in der am 12. Juni 1898 Emilio Aguinaldo vom Balkon seines Hauses die philippinische Unabhängigkeit ausrief und zum ersten Präsidenten des Landes ernannt wurde, nicht mehr wie gelebte Dystopie, sondern wie zu Hause an. Und das noch einmal mehr in Siys und Verzos Haus, das voller Bücher ist und in dem zwei Kinder wie überall auf der Welt durchs Haus toben oder mit ihren elektronischen Gadgets kommunizieren. Wir sprechen am Abend lange über Verzos „Grassroot Publishing“: Autor:innen in entlegenen Regionen oder der Diaspora werden zum Schreiben angeregt und regen damit wiederum ihr Umfeld zum Schreiben an. Dadurch sind bei Balangay Books völlig unterschiedliche Titel erschienen: Ausländer von Al Joseph Lumen, das die alltäglichen Kämpfe und stillen Triumphe philippinischer Migrant:innen in Deutschland beschreibt; Pasasaan von Jesus Aman Calvario, das den Kampf des Autors mit seiner Schizophrenie schildert; oder Sa Ika-ilang Sirkulo ng Impiyerno von Miguel Paolo Celestial – ein erschütternder Abstieg in die Hölle der Sucht, des queeren Begehrens und des Überlebenskampfs. Und natürlich der große Erfolg von Bebang Siy: A Men’s World.
Sollten wir mehr Angst vor Monstern oder vor Menschen haben?
Zwischen Monstern und Menschen – Ein Podcast mit Chuckberry Pascual

Am folgenden Mittag mache ich mich auf den Weg zurück nach Manila, dieses Mal nach Quezon City, dem mit knapp drei Millionen Einwohner:innen größten „Stadtteil“ Metro Manilas. Chuckberry Pascual wartet schon im Kandle Café, und bei Black Matcha sind wir schnell bei seiner auf Literatur.Review veröffentlichten, äußerst verstörenden Erzählung Room 202 und seinem radikalen Werk, das – wie Derain und Olan – die alte philippinische Monstermythologie der Aswangs sehr gegenwärtig und politisch amalgamiert. Und bei der Frage, ob man bei den gegenwärtigen politischen Transformationen zugunsten autokratischer Systeme inzwischen mehr Angst vor Monstern oder vor Menschen haben sollte. Pascual erklärt, dass die Politik seit Duterte selbst Familien spalte und auf Festen – nicht anders als in den USA – Politik tabu sei, was angesichts des philippinischen Hohelieds auf die Familie besonders tragisch ist. Wie Derain sieht auch Pascual sich der Schwierigkeit ausgesetzt, seine Studierenden an der University of the Philippines davon zu überzeugen, auch auf Filipino und nicht nur auf Englisch zu schreiben. Die Amerikaner seien in ihrem kurzen Kolonial-Intermezzo einfach so viel klüger als die Spanier gewesen: „Anstatt uns die Sprache vorzuenthalten, haben sie sie uns geschenkt.“ Mit all den Folgen, die bis heute virulent sind: Nicht nur die Verfassung ist auf Englisch geschrieben, auch die Gerichte funktionieren auf Englisch – und dann macht die Regierung immer wieder Druck, die Sprache der Globalisierung zu lernen, auch wenn sich die meisten Menschen nicht einmal in ihrer indigenen Sprache vor Gericht verteidigen könnten. Auch und gerade deshalb versucht er, seinen Studierenden so viel indigene philippinische Literatur wie möglich nahezubringen, um zu zeigen, dass es nicht nur in der weiten anglophonen Welt große Denker:innen und Schriftsteller:innen gibt, sondern auch in der Heimat. Allerdings führten auch sie nicht immer ein leichtes Leben: Es seien nicht nur unter Duterte Bücher verboten und Autor:innen bedroht worden, sondern gerade kürzlichsei ein Dichter ermordet worden, weil er ein erklärter Gegner der Regierung gewesen sei. Aber dennoch, betont Pascual, gebe es auch die andere Seite: so viele Autor:innen und Verleger:innen wie noch nie – auch wenn es mit den Leserzahlen nicht ganz so erfreulich sei und 500 verkaufte Exemplare schon Bestsellerstatus hätten. Das erinnert an das, was Caroline Hau in ihrem düsteren Roman Tiempo Muerto erwähnt: dass heutzutage die wichtigsten Bücher auf den Philippinen die Bibel und Kochbücher seien.
Something is terribly wrong
Schreiben zwischen Leben und Tod – Ein Podcast mit Michael Beltran
Über die von Pascual erwähnten „erklärten Gegner der Regierung“ erzählt mir der Journalist Michael Beltran ein paar Ecken weiter im Half Saints Café mehr, als mir lieb ist. Gerade als Journalist gehe es beim Schreiben weniger um wahr oder falsch als um Leben und Tod – was angesichts der von zahlreichen Menschenrechtsorganisationen zusammengetragenen Informationen plausibel erscheint. Neben dem klassischen „Red-Tagging“ benutzt die gegenwärtige Regierung unter Marcos Jr. gern das „Terror-Tagging“, um Aktivist:innen jeder Art, Politiker:innen oder Journalist:innen aus dem Verkehr zu ziehen. Allein in diesem Jahr sind es bislang 227 Aktivist:innen, die über die neuen Anti-Terror-Gesetze kaltgestellt wurden.

Beltran hat eine gerade ins Deutsche übersetzte Biografie über den Gründer der Kommunistischen Partei der Philippinen geschrieben (Der singende Gefangene und die Bibliothekarin mit nur einem Buch; im englischen Original The Singing Detainee and the Librarian with One Book: Essays on Exile“), deren Anhänger:innen und Nicht-Anhänger:innen seit den späten 1960er Jahren notorischem „Red-Tagging“ ausgesetzt waren. Auch Jose Maria Sison, kurz Joma, musste das Land verlassen und ist 2022 im holländischen Exil gestorben, wo ihn Beltran zuvor noch besuchen konnte. Aus europäischer Perspektive ist es nach den großen kommunistischen „Entfremdungswerken“ wie Koestlers Sonnenfinsternis oder Sperbers Wie eine Träne im Ozean verblüffend, dass der Kommunismus auf den Philippinen noch eine Rolle spielt. Aber wer wie Beltran eine Mutter hat, die während der Marcos-Zeit als Guerilla-Kämpferin für mehr Gerechtigkeit kämpfte und dafür gefoltert wurde, erkennt vielleicht die kleinen und großen Ungerechtigkeiten der philippinischen Gesellschaft deutlicher: einerseits ist es das einzige Land der Erde, in dem Scheidungen noch illegal sind, andererseits erhalten Menschen, die in psychiatrischer Behandlung sind, eine Ermäßigungskarte, die auch in Cafés gilt. Zwar gibt es gute private Kliniken, aber der normale Bürger muss acht Stunden auf eine kleine Behandlung warten und verliert deshalb seine Tageseinkünfte. Die Philippinen sind wirtschaftlich zwar erfolgreich, aber dennoch eines der Länder mit der markantesten sozialen Ungerechtigkeit. Dass die Menschen auch heute noch zu den Waffen greifen, liegt dann wiederum am Familien- bzw. Gemeinschaftssinn in dieser Region, betont Beltran. Denn wo es den gibt, gibt es auch „Bewegungen“, die sich schneller als anderswo zusammenschließen.
Kafka ist eine gute Möglichkeit, die Grenzen unserer Sprachen zu erweitern
Kennst du die Straßen eines Landes, kennst du das Land – hat mir einmal ein Freund während einer Busfahrt durch Uganda erklärt. Das gilt auch für die Philippinen. Anders als Jagor, der mit dem Schiff nach Bikol fuhr, die knapp 400 Kilometer entfernte Halbinsel, nehme ich den Bus, der für die Strecke zwölf Stunden benötigt. Das liegt nicht am Bus, sondern an einer absurd kleinen, immer wieder durch Baustellenengpässe versehrten Straße, die für das Verkehrsaufkommen wie ein schlechter Witz wirkt. Die kleine Straße in die Provinz ist natürlich auch politischer Wille, erklärt mir Kristian Sendon Cordero nach meiner Ankunft am späten Abend in Naga City. So lässt sich die immer schon aufständische Provinz besser kontrollieren. Cordero ist Schriftsteller, Filmemacher, Übersetzer und Kulturaktivist. Sein Kulturzentrum Savage Mind ist Buchhandlung, Kino, Galerie und Café in einem.
Aber Corderos Wirken geht weit über Naga City hinaus. Mit einem zu einer mobilen Bücherei umgebauten Pick-up-SUV fahren wir am nächsten Tag durch die Region. Cordero erzählt von „Geisterdörfern“, großen leerstehenden Häusern, die von Filipinos in der Diaspora für eine mögliche Rückkehr gebaut seien – vor allem aber in ihrer Größe vergessen lassen sollen, wie „klein“ das Leben in der Diaspora ist.
Recycling-Kunst aus dem Gartenaterlier – Ein Podcast mit Frank V. Peñones Jr.

Wir besuchen Frank V. Peñones Jr., der als Dichter, Übersetzer, Schauspieler und bildender Künstler einer der Initiatoren der bis heute anhaltenden literarischen Renaissance in Bikol ist. Eine Renaissance, die es allerdings nie einfach hatte: So wurde etwa Bikolano als Sprache in den Schulen 2024 wieder abgeschafft, weil im Vergleich zum Landesdurchschnitt die Mathematikergebnisse schlechter ausgefallen seien. Peñones erzählt mir von seinen Anfängen als Autor und Aktivist und von seinem heutigen Schwerpunkt als bildender Künstler – Arbeiten, die in einem Open-Air-Atelier in Iriga City entstehen und hauptsächlich aus recycelten Materialien bestehen.
Skulpturen, Autos und Gemälde – Ein Podcast mit Cesar Gumba
Gemeinsam mit Peñones fahren wir am erloschenen Mount-Iriga-Vulkan vorbei, an dessen Ausläufern Jagor Feldforschungen anstellte, und besuchen einen weiteren Künstler, Cesar Gumba, der neben großen Gemälden und Skulpturen auch an einem beeindruckenden Wagenpark werkelt und jenen „Oldtimer“ wieder zum Leben erwecken will, den ihm einst sein Vater schenkte, nachdem er sich gegen den Willen der Eltern für die Kunst entschieden hatte.

Gumbas Kunst umgibt mich dann einen Tag später in ihrer ganzen, faszinierenden Komplexität, denn Cordero hat eine kleine Podiumsdiskussion in der Galerie seines Kulturzentrums organisiert.
Mit Mia Tijam, Dr. Mary Jane Guazon Uy und Trixie Adviento Odiamar spreche ich eingehend über die Werke der Autorinnen und bin einmal mehr über die so diversen wie komplexen Hintergründe der besprochenen Literatur begeistert: Die Kolonialgeschichte und ihr Widerhall in der Gegenwart sind ebenso Thema wie die sich verändernden Geschlechteridentitäten von vorkolonialer Zeit bis in die Gegenwart, der weiterhin anhaltende bewaffnete Widerstand in der Region und natürlich die Geschichte und die Sprachen Bikols und ihre Rolle innerhalb der philippinischen Sprachenvielfalt.
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft - Ein Videocast mit Mia Tijam, Dr. Mary Jane Guazon Uy und Trixie Adviento Odiamar
Welche Chancen sich durch diese Vielfalt ergeben, erklärt mir Cordero, nachdem wir lange über seine Erzählung Santiago’s Cult gesprochen haben, die Anfang August auf Literatur.Review erschienen ist. Die Erzählung – eine brutale Gratwanderung zwischen Zärtlichkeit und Grausamkeit während der Zeiten des Kriegsrechts unter Marcos – liege für ihn lange zurück; er arbeite im Moment an Geschichten über andere Grauzonen der Gewalt und darüber, wie die Einführung der Beichte die Identität der Menschen Bikols verändert hat. Im Großen und Ganzen gehe es dabei immer um den liminalen Limbo.

Das klingt für mich wie seine Übersetzung von Kafkas „Verwandlung“, die er nicht nur ins Bikolano übertragen, sondern sich die Freiheit genommen hat, das Käfergebrabbel Gregors in eine weitere Bikolano-Sprache, das Rinconada, zu übertragen. Es sei eine regelrechte Freude gewesen, die Sprachen an ihre Grenzen zu führen, erklärt Cordero. Und das mit dieser Geschichte, die ihm auch deswegen so wichtig sei, weil er immer schon offen für kafkaeske Literatur gewesen sei, ohne es damals überhaupt zu wissen – etwa als er als Kind dem Märchen vom Mädchen und der Ananas lauschte.
Zwischen Gewalt, Sprache und Schlaf – Ein Podcast mit Kristian Sendon Cordero
Als ich ihn abschließend frage, wie er das alles zusammenbringe – Kulturaktivismus, Literatur und dann auch noch das Filmemachen, ganz zu schweigen vom Wiederaufbau seines Zentrums nach den schweren Überflutungen im letzten Jahr –, lächelt Cordero: „Wir müssen einfach genug schlafen und richtig kauen. Die Leute schlafen einfach nicht – und sie kauen nicht richtig.“
Es ist ein Glücksspiel, auf Filipino zu schreiben
Zwischen Slum, Sprache, Schnitt und Sound – Ein Podcast mit Ronaldo S. Vivo Jr.
Am Ende meiner Reise bin ich – wie Jagor – wieder in Manila und sitze erneut in einem städtischen Großraumbüro. Dieses Mal allerdings nicht im CCP bei Bebang Siy, sondern im alten Flügel des Rathauses von Makati, in der Abteilung für Stadtplanung. Hier verdient einer der erfolgreichsten und konsequent auf Filipino schreibenden Autoren des Landes sein Geld. Allerdings, erklärt Ronaldo S. Vivo Jr., Autor der erfolgreichen Dreamland-Trilogie, habe er keine große Wahl gehabt – auch wenn es ein Glücksspiel sei, auf Filipino zu schreiben. Er habe es zunächst mit Selfpublishing versuchen müssen, weil niemand ein derartiges Werk auf Filipino habe veröffentlichen wollen. Vivo ist in einer Familie in den Slums groß geworden; seine Mutter habe mit dem Verkauf von Enteneiern ihr Geld verdient, sein Vater als Anstreicher. Und da das Haus wegen seines Vaters voller Hongkong-Filme und einer Sammlung mit Pacino- und De-Niro-Filmen gewesen sei, ganz zu schweigen von all den Comics, sei das auch sein eigentliches Rollenmodell fürs Schreiben gewesen. Er schreibe, wie man Filme schneidet, und auch die Genres – Martial Arts, Noir und Hardboiled Crime – hätten ihn geprägt.

Dass die Trilogie dann solch ein Erfolg geworden sei, war auch nach den ersten Selfpublishing-Erfolgen nicht abzusehen. Auch weil die Bücher das Regime unter Duterte kritisierten und er sich gegen Cyberattacken jeder Art wehren musste; deshalb bediene er auch heute keinerlei Social-Media-Account mehr. Bis zum Erfolg mit seiner Trilogie habe er eigentlich nur Zero-Budget-Kurzfilme gemacht und vor allem für Bands das Schlagzeug gespielt. Was er auch heute noch tue: Psychedelic Rock, Post- und Death Metal sowie Hardcore Punk – Bands wie Basalt Shrine, Abanglupa, The Insektlife Cycle, Dagtum und Imperial Airwaves. Das sei jetzt weniger geworden, weil das Schreiben mehr Raum einnehme. Er habe eine neue Trilogie begonnen, in der nicht mehr so ausgiebig geflucht werde – im Filipino gebe es immerhin hundert Wege, „fuck“ zu sagen, und Fluchen sei nun mal Teil des Alltags in den Slums, ob positiv oder negativ –, sondern in der die philippinische Geschichte Thema sei. Die „Arson“-Trilogie, deren erster Band auf die unbekannten Helden der Revolution und die Kolonialzeit fokussiert, werde dann auch die amerikanische Kolonialisierung und die Besatzung durch die Japaner behandeln. Auch das – selbstverständlich – auf Filipino. Ich denke an Ngũgĩs Decolonising the Mind und daran, wie Sprache dekolonisiert; und Vivo scheint Ngũgĩs Gedanken zu bestätigen, als er von einem Abend in einem Lesekreis erzählt, dessen Mitglieder ihm gestanden, dass sein Werk das erste auf Filipino geschriebene Buch gewesen sei, das sie gelesen und besprochen hätten. Und das ihnen dann auch noch gefallen habe.
Wenn ich auf den Philippinen geblieben wäre, wäre ich eine andere Schriftstellerin
Zwischen alter und neuer Heimat – Ein Podcast mit Cecilia Manguerra Brainard
Hätte ich einen magischen Wunsch offen, dann würde ich einem Anthropologen der alten Schule wie Fedor Jagor eine Zeitreise in unsere Gegenwart spendieren. Wie würde er mit den Begegnungen dieser literarischen Reise, die seinen geografischen Spuren folgte, umgehen, und wie würde er das Konzept unserer heutigen globalisierten Welt begreifen, zu dem auch gehört, dass Menschen und Autor:innen ihr Land verlassen und Teil einer anderen Kultur werden? So wie Cecilia Manguerra Brainard, die schon als junges Mädchen einer bildungsbürgerlichen Mittelklassefamilie in Cebu City mit dem Schreiben begann und als junge Frau nach Kalifornien ging, um dort Film zu studieren – am Ende dann aber doch beim Schreiben blieb und eine der erfolgreichsten Autorinnen der philippinischen Diaspora in den USA wurde. Ich erreiche sie über einen Zoom-Call in ihrem Haus in Santa Monica, und trotz der Ferne ist das Gespräch ähnlich nah und vertraut wie eigentlich mit allen Autor:innen, die ich auf meiner Reise getroffen habe.

Trotz der geografischen Distanz ist Brainard immer auch eine philippinische Autorin; sie besucht das Land regelmäßig. Und ihre Geschichten sind dann auch immer wieder Geschichten aus Cebu – allerdings auf Englisch geschrieben, weil sie auf Englisch erzogen worden sei und nicht in Cebuano. Dennoch, da ist sie sich sicher, wäre sie eine sehr andere Autorin, wäre sie auf den Philippinen geblieben. Sie teile zwar nicht das Schicksal von Thomas Mann, dessen Zeit im Exil sein Schreiben und Denken nachhaltig verändert habe, aber sie sei auch eine „PhilAm“-Autorin, deren Romane wie The Newspaper Widow Erinnerung, Kolonialgeschichte und weibliche Selbstbestimmung verweben und die sich auch mit Segen und Fluch der amerikanischen Verlagswelt auseinandersetzen habe müssen: mal gewollt, dann wieder verstoßen, wenn die Verkaufszahlen nicht stimmen. Damit sei sie inzwischen im Reinen; ihre Bücher würden zudem in zahlreiche andere Sprachen übersetzt. Mehr Sorgen mache ihr der Schwund an „Hochliteratur“, auch wenn sie selbst den neuen, „modischen“ Genres und ihren Autor:innen zugestehe, dass auch sie mit Sicherheit ihr Bestes geben. Doch so wie Bebang Siy sagt auch Brainard, dass die Philippinen mehr „ernste“ Literatur brauchen, um die Gegenwart und Zukunft mit all ihren Krisen in den Griff zu bekommen.
Und vielleicht auch – wie mir Justin, ein Student der Polytechnischen Universität an meinem letzten Tag in Manila, im legendären, von der Schließung bedrohten Buchladen Solidaridad begeistert vermittelt – einen neuen Kulturbegriff, der an die vorkoloniale Zeit anknüpfen könnte, als Musik und Vorträge noch für alle kostenlos und öffentlich zugänglich waren.
Hat Ihnen dieser Text gefallen? Dann unterstützen Sie doch bitte unsere Arbeit einmalig oder monatlich über eins unserer Abonnements. Wir würden uns freuen!
Wollen Sie keinen Text mehr auf Literatur.Review verpassen? Dann melden Sie sich kostenlos für unseren Newsletter an!




