Im Mondschein durch die nächtliche Kälte fahrend

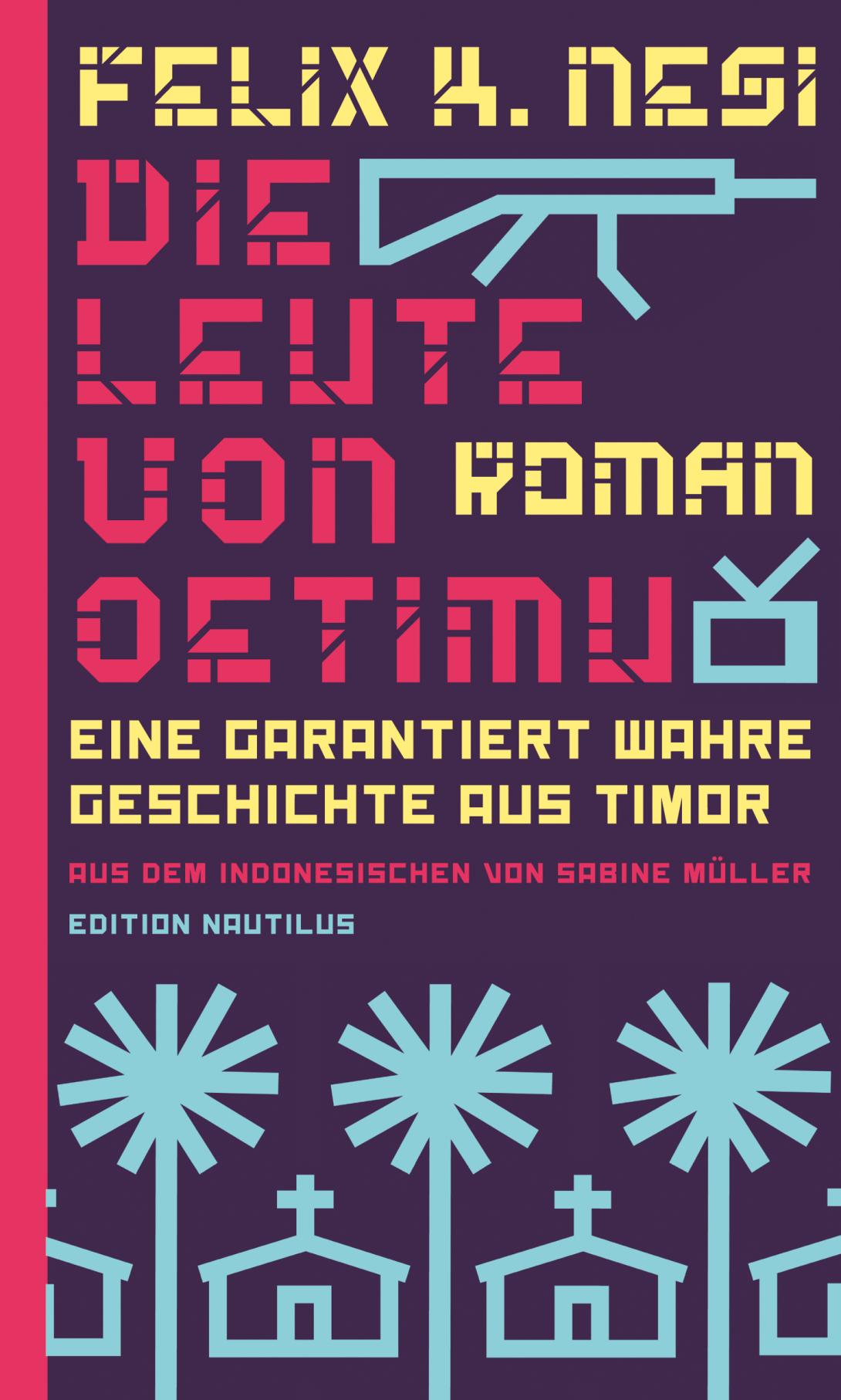 Edition Nautilus
Edition NautilusFelix K. Nesi | Die Leute von Oetimu | Edition Nautilus | 312 Seiten | 25 EUR
Wer David van Reybroucks auf über 200 Zeitzeugen basierende, packende historische Erzählung Revolusi über Indonesiens Unabhängigkeitskampf und die überraschende Rolle Indonesiens in der sich rapide wandelnden Weltordnung nach dem 2. Weltkrieg gelesen hat, der möchte eigentlich gar nicht mehr aufhören, sich mit der komplexen Geschichte des viertbevölkerungsreichsten Staates der Erde beschäftigen.
Nicht nur deshalb kommt Felix K. Nesis Roman Die Leute von Oetimu gerade recht, denn Nesis ältester Held Am Siki könnte tatsächlich einer von Reybroucks Zeitzeugen sein , hat er doch die japanische Besatzung noch miterlebt und weil er eines ihrer Arbeitslager niedergebrannt hat, ist er sogar einer der Helden von Oetimu, einem kleinen Ort auf der fern vom javanischen Zentrum Indonesiens gelegenen Insel Timor. Doch das ist natürlich nicht der Kern der Erzählung Nesis, wenn auch so etwas wie das Wurzelwerk eines erzählerischen Feuerwerks, das wie alle Wurzeln weiterverzweigt in die Tiefe und hoch in den Himmel strebt.
Denn eigentlich beginnt Nesi seinen 300 Seiten langen Roman mit einer TV-Party des Dorfpolizisten Ipi, der alle Männer von Oetimu eingeladen hat, mit ihm das Finale der Fußball-WM 1998 zwischen Brasilien und Frankreich zu sehen und die baldige Heirat mit der jungen, hochbegabten Silvy zu feiern. Von diesem Ereignis hangelt sich Nesi über Ipi und Silvy tief hinab in so tragische wie groteske Lebensgeschichten Timors, ohne dabei die politischen Wirren außer Acht zu lassen, die die Vergangenheit genauso bestimmt haben wie die hier erzählte Gegenwart und sich größtenteils über die New-Order-Jahre unter Präsident Suharto schildern, der mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln, nicht nur die Unabhängigkeit eines Teils von Timor verhindern will, sondern das ganze Land mit einem gnadenlosen autokratischen Populismus, Vetternwirtschaft und Korruption, durchseucht hat. Die so süffisanten wie gnadenlosen Beschreibungen dieser Politik und die Auswirkungen auf die hier geschilderten privaten Lebenslinien wirken allerdings fast tagesaktuell, denn wie jeder autokratische Populist griff auch Suharto zu Mitteln, die mit einem schnellen Blick auf die Entwicklungen in den USA, Russland oder China mit heutigen Strategien beängstigend deckungsgleich sind.
Doch Nesis Roman ist alles andere als ein aktivistischer Roman. Stattdessen erzählt Nesi vor allem vom prallen Leben und Leiden seiner Protagonisten und das mit einer Intensität, die den Leser immer wieder schwindeln lässt. Deftiger Sex steht neben katholischer Enthaltsamkeit und dem Versuch aller Beteiligten, das Beste aus ihrem Leben zu machen, ganz egal wie schwer die Last der Vergangenheit und Gegenwart auch wiegen mag.
Das großartige an diesem Roman sind jedoch nicht nur die mit den Lebensvignetten verwobenen, fast schon ethnografisch-dokumentarischen Momente wie die nächtliche und letzte Motorradfahrt von Ipi, die Nesi mit filmischer Dichte zu schildern weiß und die azf eine Region Indonesiens fokussieren, die anders als das Zentrum des Landes, nicht muslimisch, sondern durch die jahrhundertelange Besatzung der portugiesischen Kolonialmacht, katholisch geprägt ist. So wie der Islam auf Java und in anderen Regionen jedoch nicht unbedingt dem entspricht, was der westliche Blick erwartet und wie es die Schriftstellerin und Literaturwissenschaftlerin Nenden Lilis Aisyah im Interview eindrücklich beschreibt, so ist es bei Nesi auch mit dem Katholizismus und seiner Durchdringung in den Alltag etwas anders bestellt. Doch neben diesen überraschenden Szenarien überrascht Nesi auch durch seine Erzählweise, die an die Traditionen oraler Erzählkultur nicht nur auf Timor anknüpft. Das bedeutet, dass vor allem über das Personal subkutan narrative Fäden gesponnen werden und sich mit jeder neu „eingeführten“ Person immer tiefer in die Vergangenheit bewegt wird, um dann irgendwann wieder am Anfang der erzählerischen Spirale zu stehen, dem Jahr 1998 und dem Finale der Fußball-WM.
Obgleich Nesi mit seinem in Indonesien überaus erfolgreichen Roman – er befindet sich inzwischen in der sechsten Auflage – gezeigt hat, dass auch die Literatur aus der kulturellen Peripherie des Landes ihre Berechtigung hat, erinnert gerade die Bedeutung von Gewalt, die sich nicht nur durch die erzählerische Einbindung von Propagandafilmen wie Pengkhianatan G30S/PKI und die Rechtfertigung der Massaker nach dem 30. September 1965 durch den Roman zieht, auch an Autoren aus dem Zentrum des Landes wie Hamsad Rangkuti und etwa seine Erzählung Sukri steckt das Messer ein.
Felix K. Nesis Erzählung aus kolonialen Zeiten - Käpt’n will nach Dili gehen - auf Literatur.Review
Wie Rangkuti und übrigens auch komplexe Lyrik in Indonesien, besitzt auch Nesi die Gabe eines subtilen, befreienden Humors, der den Terror, die allseits präsente Gewalt zusammen mit den Miseren des Alltags nicht nur erträglich macht, sondern einen fast schon heilsamen, ja versöhnlichen Charakter hat, ohne dabei jemals die Kritik an der bestehenden Misere zu einem kleinlauten Gemeckere verkümmern zu lassen. Das macht Nesis Roman auch in der sprachlich funkelnden und vibrierenden deutschen Übersetzung von Sabine Müllernicht nur zu einem besonderen, sondern vor allem auch zu einem universalen Werk, das nicht nur Leser, die David van Reybrouck gelesen haben, begeistern dürfte.



