"Sich finden, ohne sich dabei zu verlieren"

Halldór Guðmundsson, 1956 in Reykjavík geboren, wuchs in Deutschland auf und studierte in Dänemark. Er leitete viele Jahre Mál og menning, damals Islands größten Verlag, und veröffentlichte mehrere Bücher – darunter die maßgebliche Biografie über den isländischen Nobelpreisträger Halldór Laxness. Später stand er an der Spitze von Harpa, dem Konzert- und Konferenzhaus von Reykjavík, und verantwortete zweimal das Programm eines Ehrengastlands der Frankfurter Buchmesse: Island (2011) und Norwegen (2019).
Axel Timo Purr traf Guðmundsson in einem kleinen Fischrestaurant im Stadtzentrum von Reykjavík.
Halldór Laxness (1902–1998) wuchs auf dem Bauernhof Laxnes bei Reykjavík auf, dessen Namen er später annahm. Nach frühen Reisen konvertierte er 1923 kurzzeitig zum Katholizismus, wandte sich jedoch in den 1930er-Jahren sozialistischen und kommunistischen Ideen zu, geprägt durch Aufenthalte in der Sowjetunion. Er wurde zu Islands bedeutendstem Erzähler, bekannt für international übersetzte Werke wie 'Salka Valka', 'Sein eigener Herr' und 'Die Islandglocke'. 1955 erhielt er den Nobelpreis für Literatur für die Erneuerung der isländischen Erzählkunst.
Axel Timo Purr: Lass uns über Halldór Laxness reden. Ich hätte mir vor einem halben Jahr nicht träumen lassen, dass ich jetzt hier in Island über ihn sprechen würde, weil ich eigentlich seit 30, 35 Jahren nicht mehr an ihn gedacht habe. Ich habe ihn mit 20 gelesen, mit Begeisterung gelesen und dann verschwand er langsam für mich.
Als ich jetzt im Sommer auf den Philippinen war, viele Autor:innen getroffen und ihre Bücher gelesen habe, musste ich ganz plötzlich wieder an Laxness denken. Ich habe lange überlegt, warum das so ist. Und dann kam dieser Gedanke der Ähnlichkeit:
Wenn du auf die Philippinen schaust – also auf den globalen Süden – mit ihren Vulkanen, ihrer Mythologie, die heute wieder bewusst in die Literatur eingebunden wird und als Teil eines Dekolonisierungsprozesses funktioniert, mit den Mythen, den alten Erzählungen und Sagen – dann landet man bei ähnlichen Fragen wie bei Laxness.
In dieser Literatur geht es – zumindest für mich – weniger um Sprachexperimente, sondern um erzählerische und inhaltliche Wucht, um Geschichten, die etwas wollen. Vor allem geht es um die Suche nach einer nationalen Identität, nach einem Selbstbild, das sich aus der Kolonialgeschichte herausarbeitet.
Und da musste ich plötzlich wieder an Laxness denken. Ich habe mir die Frage gestellt, ob Laxness nicht in gewisser Weise auch ein Autor des „globalen Südens“ ist – in Anführungszeichen –, weil er ähnliche Themen bearbeitet und in Literatur verwandelt hat.
Deshalb wollte ich dich als Laxness-Spezialisten fragen, wie du das siehst – dich, der du eine sehr umfangreiche Biografie über Laxness geschrieben hast.
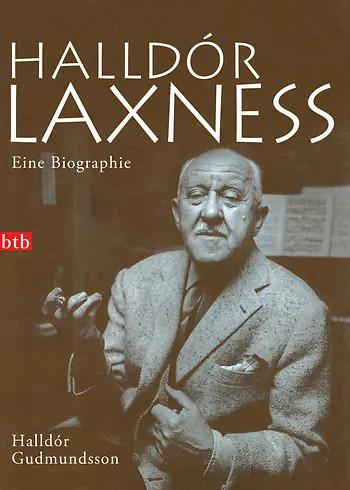 btb
btbHalldór Guðmundsson | Halldór Laxness: Eine Biographie | btb | 864 Seiten | 49,95 EUR
Halldór Guðmundsson: Was ich aber zu deinem Philippinen-Vergleich sagen wollte – den finde ich hochinteressant, obwohl ich ihre Literatur überhaupt nicht kenne: Laxness war in vielem die Personifizierung der Moderne, mit all ihren Brüchen.
Er kam als sehr junger Mann nach Europa, kurz nach dem Ersten Weltkrieg, und reiste viel herum. Später ging er nach Amerika, nach Los Angeles, nach Hollywood, weil er der Welt seine Geschichten erzählen wollte und glaubte, das ginge am besten über den Film. Gleichzeitig schrieb er dauernd Artikel in isländischen Zeitungen und sagte den Leuten, sie müssten jetzt die moderne Kultur, die Massenkultur kennenlernen.
Wenn er aber schrieb, literarisch, dann war er immer dort, was du gerade über die Philippinen beschrieben hast: auf der Suche nach einer isländischen Identität. Nach den alten Sagas, nach den Volkserzählungen, Gedichten und Liedern, die uns seit Jahrhunderten begleiten.
Alle seine Romane spielen in Island. Es ist tatsächlich so, dass seine Figuren zum Teil in den alten Handschriften suchen und dort etwas finden. Und dass es um das Überleben dieser alten Identität geht.
Ist Laxness für dich also tatsächlich so etwas wie eine literarische Figur des Dekolonisierungsprozesses? Jemand, der versucht, sich über Sprache, Sagen, Mythen und eine neue Literatur von Jahrhunderten dänischer Herrschaft zu emanzipieren?
Ja, ganz bestimmt – vor allem in der späteren Phase seines Lebens, aber die Tendenz ist früh da. Schon in seinem Roman 'Der große Weber' von Kaschmir spielt das eine Rolle.
Den habe ich nie gelesen.
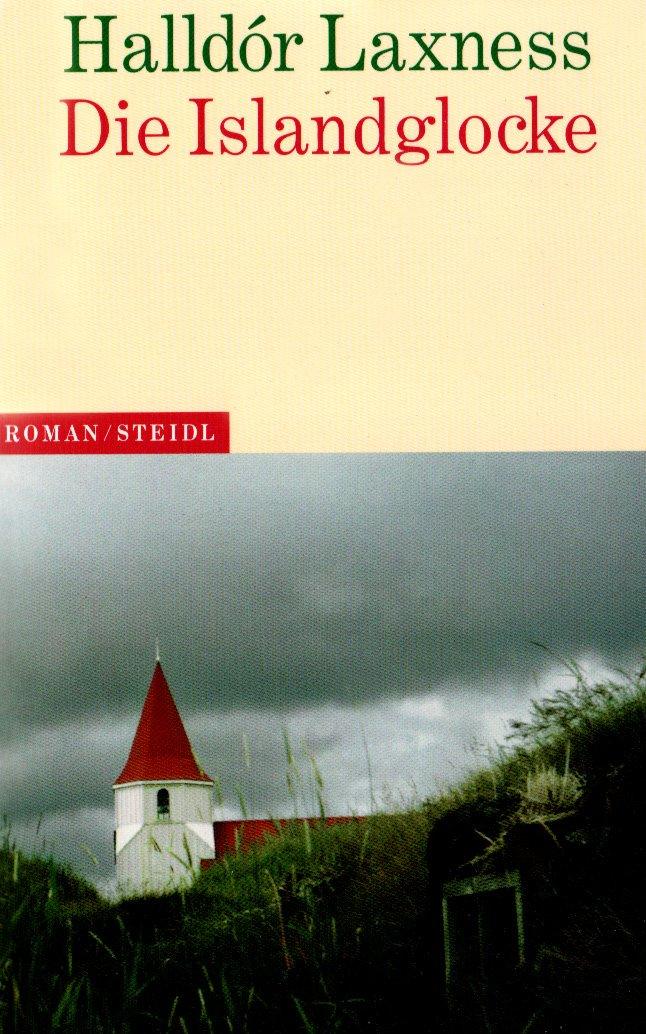 Steidl
SteidlHalldór Laxness | Die Islandglocke | Steidl | 448 Seiten | 12,90 EUR
Den haben im Ausland, glaube ich, generell nicht viele gelesen. Aber es gibt ihn auf Deutsch, und inzwischen auch in anderen Sprachen, auch auf Englisch. Da geht es darum, dass Island ein armes, primitives Land sei, das die europäische Kultur, die Moderne kennenlernen müsse – und darum, dass Frauen lernen müssen, sich zu emanzipieren. Es geht um die Zeichen der Moderne.
Später, in den 1930er-Jahren, als er seine großen Romane schreibt, geht es ihm darum, den Isländer oder die Isländerin in einem ganz kleinen Dorf oder auf einem Bauernhof in der Heide oder im Nordwesten zu beschreiben – und gleichzeitig aus diesem Mikrokosmos einen Makrokosmos zu machen.
So etwa in Salka Valka und natürlich in der Islandglocke. In der Islandglocke passiert genau das, was du eben beschrieben hast: Da geht es darum, das Land zu dekolonisieren, auch kulturell. Es ist der erste Roman, der sich explizit mit der Kolonialzeit beschäftigt. Und das war synchron zu dem, was im Rest der Welt passierte.
Die Islandglocke wurde im Zweiten Weltkrieg geschrieben. Laxness musste damals in Island bleiben, er konnte nicht mehr reisen. Zuvor war er zwanzig Jahre unterwegs: in Russland, in Paris, in Südamerika, bei Kongressen mit Stefan Zweig, überall. Jetzt musste er jahrelang hierbleiben. In dieser Situation wandte er sich zwangsläufig den alten Sagas, unseren Traditionen, den Geschichten zu.
Also aus einer Art von Hausarrest heraus?
Ja, „Hausarrest“ trifft es ganz gut – er saß fest. Und genau in dieser Zeit schrieb er die Islandglocke über die schlimmsten Jahre der dänischen Kolonialzeit: die großen Hungersnöte, die Jahre, in denen Kirchenglocken aus Island nach Kopenhagen gebracht und dort eingeschmolzen wurden, um Dächer zu decken; die Zeit, in der alte Handschriften und Manuskripte eingesammelt und nach Dänemark gebracht wurden.
Er schrieb über die Zeit um 1700, weil er wichtig fand, dass die Dekolonisierung auch Teil unserer eigenen Identitätsfindung wird. Die Islandglocke hatte enormen Einfluss. Viele Isländer haben Jahrzehnte später die dänische Vergangenheit so gesehen, wie er sie geschildert hat. Ganz genau so war es zwar nicht, historisch gesehen – aber für die isländische Vorstellung von Geschichte war das entscheidend.
Und für ihn persönlich war interessant, dass die Islandglocke sein erstes Buch war, das sich in Island wirklich gut verkauft hat.
Da sehe ich dann wieder eine Parallele zur philippinischen Literatur. Die meisten Autorinnen auf den Philippinen schreiben seit Jahrzehnten auf Englisch – der Sprache der amerikanischen Kolonisatoren – weil es sich besser verkauft, und weil es ohnehin wenige Leserinnen gibt. Deshalb frage ich mich, wie das in Island funktioniert hat – mit dieser kleinen Sprache und so wenigen Leser:innen.
Das war ein riesiges Problem, als Laxness anfing. Es gab keinen einzigen professionellen Autor, der vom Schreiben auf Isländisch leben konnte. Als er um die 20 war, wollte er unbedingt Schriftsteller werden, seine Geschichten der Welt erzählen. Aber es gab praktisch keine Chance, dass er als isländischer Autor davon leben konnte.
Einige vor ihm – wie Gunnar Gunnarsson – wurden Autoren auf Dänisch. Andere schrieben auf Norwegisch. Damit konnte man etwas verdienen.
Und Laxness hat trotzdem immer auf Isländisch geschrieben?:
Er hat seine Romane immer auf Isländisch geschrieben, ja. Das war im Kern eine radikale Entscheidung. Aber nicht ganz so radikal, wie er später selbst behauptet hat.
Er hat in jungen Jahren auch Kurzgeschichten auf Dänisch verfasst. Als er mit 17 nach Kopenhagen kam, schrieb er eine Kurzgeschichte auf Dänisch für die damals wichtigste Zeitung in Dänemark. Er kaufte sich extra einen Dreiteiler, um älter auszusehen, und verkaufte dieser Zeitung eine Geschichte, die dann auf der Titelseite der Sonntagsausgabe erschien.
Damals konnte er sich durchaus vorstellen, auf Dänisch zu schreiben. Später, als er in Europa herumreiste und nach Los Angeles zog, um einen Film zu schreiben, verfasste er das Drehbuch auf Englisch.
Das berühmte Drehbuch, das die Grundlage von Salka Valka wurde?
Genau. Ich glaube, er hatte es bei Universal eingereicht, jedenfalls bei einem großen Studio. Er schickte es einfach hin – bei einer Konkurrenz von angeblich 40.000 eingereichten Manuskripten.
Ich habe nie wirklich verstanden, warum er überhaupt glaubte, er könne seine großen Geschichten als Stummfilm erzählen. Und er bestand darauf, dass das Ganze in Island spielen sollte. Das war, aus Studiosicht, völlig verrückt.
Ende 1929 kehrte er nach Island zurück und sagte sich: Dann mache ich es eben auf Isländisch, ich werde isländischer Autor. Aber es ist nicht so, dass er das zehn Jahre vorher schon als konsequenten Plan im Kopf hatte.
Aber wie kann das funktionieren – mit so wenigen Menschen, so wenigen Leser:innen? Er brauchte doch irgendeine Form von öffentlicher Unterstützung.
Die bekam er auch, auf eine sehr konkrete Weise: Seine Mutter hat den Bauernhof und so ziemlich alles verkauft, um ihn zu unterstützen.
Außerdem war er früh aktiv darum bemüht, seine Bücher übersetzen zu lassen. Zunächst natürlich ins Dänische. Er schloss einen Vertrag mit einem isländischen Autor, der damals in Dänemark schon ziemlich bekannt war, d.h. dem vorhin schon erwähnten Gunnar Gunnarsson. Dieser übersetzte Salka Valka. Das war die erste große Übersetzung.
Dann kam eine englische Ausgabe. Und dann kam der Zweite Weltkrieg – und riss erst einmal ein Loch in seine Karriere.
Während des Krieges entwickelte sich dann aber so etwas wie ein echter Buchmarkt auf Isländisch. Zum ersten Mal war es möglich, zwar nicht bequem, aber immerhin in Ansätzen vom Schreiben zu leben. Die Leute auf dem Land bekamen ihren Lohn zunehmend in Geld, nicht mehr in Naturalien, und eine Zeitlang waren hier fast 50.000 ausländische Soldaten stationiert. Es wurde viel gebaut, die Wirtschaft veränderte sich – und damit auch der Buchmarkt.
Kam der Nobelpreis für ihn überraschend? Island war ja – literarisch gesehen – doch eine eher „abseitige“ Region. Und das Nobelpreiskomitee dürfte seine Romane doch meist in Übersetzungen gelesen haben?
Einige Mitglieder der Schwedischen Akademie konnten Isländisch, die nordische Verbindung war damals noch sehr lebendig. Als er den Nobelpreis entgegennahm, hielt Elias Wessén, der Vorsitzende, die Rede teilweise auf Isländisch. Er war Sprachwissenschaftler.
Für Laxness selbst kam der Preis nicht völlig überraschend. Er war drei, vier Jahre lang immer wieder als möglicher Laureat im Gespräch, und die Akademie hatte mehrmals über ihn diskutiert.
In Deutschland, England oder Amerika kannte ihn damals kaum jemand. Aber in den nordischen Ländern war es keine große Überraschung. Man hatte wirklich das Gefühl, die Schwedische Akademie würde irgendwann schon sagen wollen: Es gibt diese eigenständige, großartige literarische Tradition auf Island.
Das Verrückte ist ja, dass ein Roman wie Sein eigener Herr stark an Hamsuns Segen der Erde, der Roman des norwegischen Literaturnobelpreisträgers erinnert.
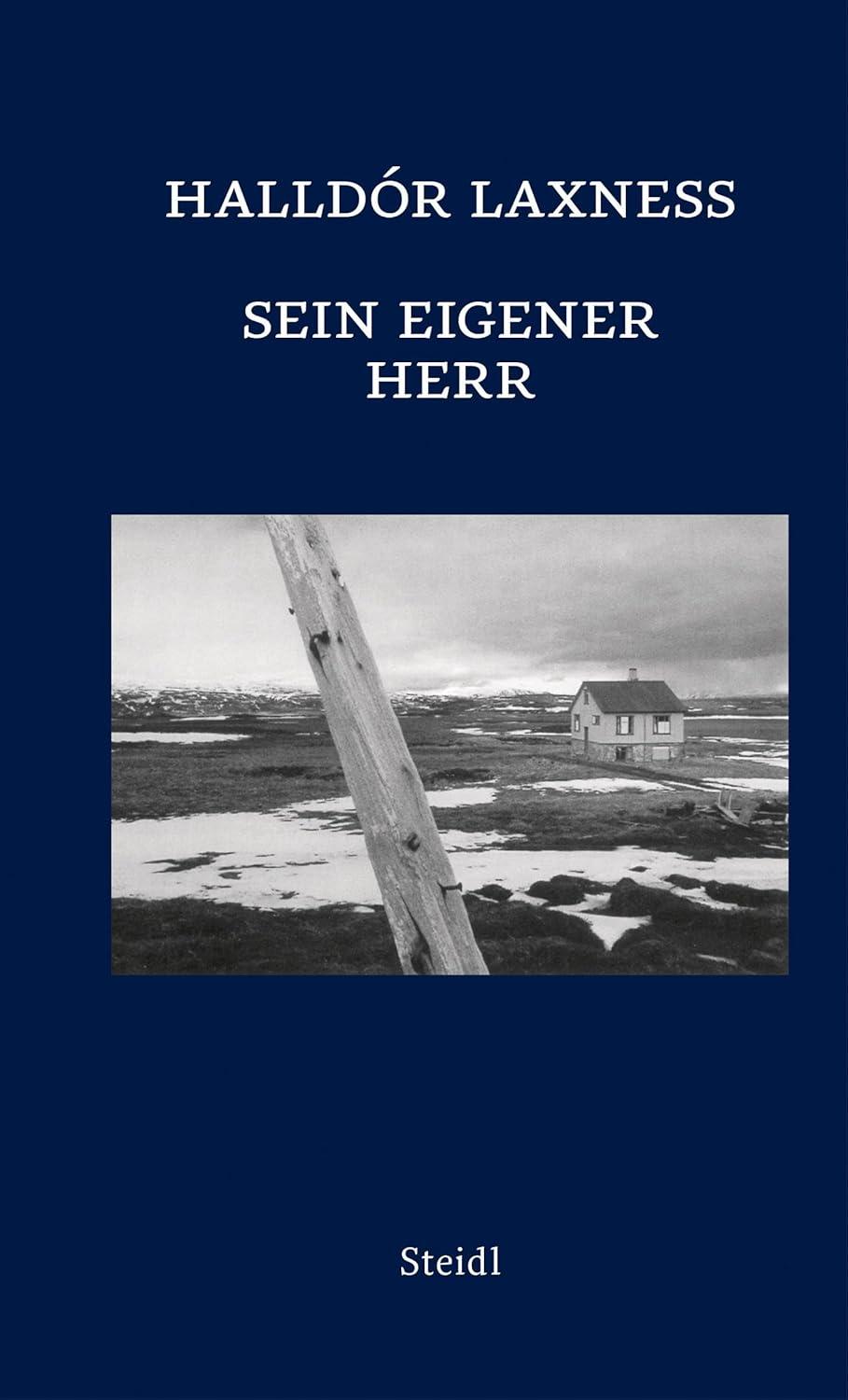 Steidl
SteidlHalldór Laxness | Sein eigener Herr | Steidl | 560 Seiten | 12,90 EUR
Das ist auch bewusst gegen Hamsun geschrieben.
Ich habe auf Wikipedia gelesen, wo du zitiert wirst, dass Laxness eine Geschichte über einen starken Mann schrieb und dass Hamsun als Kulturpessimist mit Segen der Erde eine Art Komödie verfasst habe, während Laxness als Kulturoptimist eine Tragödie schrieb.
Ich muss gestehen: Ich habe Segen der Erde nie als Komödie gelesen. Für mich war das immer ein tief ernstes Buch über den Bruch mit der Zivilisation, ein großartiges Werk, aber nicht komisch.
„Komödie“ ist da vielleicht das falsche Wort. Sein eigener Herr ist ganz klar als Tragödie konstruiert: fünf Teile, und in jedem Teil verliert die Hauptfigur etwas. Es ist eine Aufstieg-und-Verlust-Geschichte, eine Tragödie des Bauern.
Segen der Erde verbreitet hingegen eine Art Glückseligkeit, eine pastorale Vision. Es ist wahnsinnig pathetisch. Und die Isländer hatten immer große Schwierigkeiten, dieses Buch ernsthaft auf ihre Situation zu übertragen.
Wir waren eine Bauerngesellschaft, sehr lange. Aber die Verherrlichung dieser bäuerlichen Welt funktionierte hier nicht – sie wirkte seltsam, fast grotesk. Armut bedeutete hier nicht idyllische Einfachheit, sondern immer wieder Scheitern.
Und da sind wir wieder bei der Parallele zum globalen Süden: das sind auch Gesellschaften, in denen Armut nicht romantisiert werden kann.
Und auch dort ist die Natur übermächtig: Erdbeben, Vulkane, Überschwemmungen, Monsune, die Wassermassen. Und natürlich gilt immer: Jeder kann jederzeit scheitern, aus Gründen, die außerhalb seiner Kontrolle liegen.
Genau. Der, der heute Erfolg hat, kann morgen ein armer Mann sein. Die Natur ist überwältigend.
Das ist die Ähnlichkeit zwischen Hamsun und Laxness: Beide schreiben an der Grenze zur Zivilisation. Die Figuren sind dadurch oft „larger than life“. Manchmal wirken sie im städtischen Milieu nicht ganz glaubhaft – aber als Leser:in identifiziert man sich mit ihnen, weil dieser Konflikt spürbar ist: zwischen unkontrollierbarer Natur und zaghafter Zivilisation.
Ende des 19. Jahrhunderts war Island eines der ärmsten Länder Europas, zusammen mit Albanien und Nordnorwegen. Genau diese Grenze des Überlebens beschäftigte Hamsun – und auch Laxness.
Ich bin sicher, vieles von dem, was du auf den Philippinen gesehen hast, kreist um ähnliche Fragen.
Haben sich Laxness und Hamsun jemals persönlich getroffen?
Ich hatte sehr gehofft, bei der Arbeit an der Biografie eine solche Begegnung zu finden. Ich war ein großer Bewunderer Hamsuns, habe alle Biografien über ihn gelesen und die Orte besucht, die wichtig in seinem Leben waren.
Im Mai 1930 gab es ein nordisches Autorentreffen in Oslo. Es war alles da, was Rang und Namen hatte – nur Hamsun erschien nicht. Ich hatte gehofft, sie hätten sich dort getroffen, aber leider nein.
Laxness war von Anfang an stark von Hamsun beeindruckt. Und die Gruppe der sozialistischen Autoren in den 1930ern, zu der er gehörte, waren fast alle begeisterte Hamsun-Leser. Mein Großvater gehörte dazu; er besaß das Gesamtwerk Hamsuns und zeigte schon vor meinem 14. Lebensjahr darauf und sagte: „Das musst du lesen.“
Ich würde gerne eine Klammer aufmachen, bevor ich es vergesse: Manès Sperber etwa war in den 1920ern auch überzeugter Kommunist. Nach seiner ersten Reise nach Moskau brach er mit dem Kommunismus und schrieb später den Roman Wie eine Träne im Ozean, in dem er genau diese Brüche und das Lösen von einer totalitären Ideologie beschreibt. Ist so etwas bei Laxness jemals passiert?
Leider nur sehr unzureichend.
1933 besuchte er zum ersten Mal die Sowjetunion, auch die Ukraine – genau zu der Zeit der furchtbaren Hungersnot. Er schrieb anschließend ein journalistisches Buch darüber, in dem er schilderte, wie wunderbar in der Sowjetunion alles sei. Vieles darin ist schlicht gelogen oder verdrängt.
Bei seinem zweiten längeren Aufenthalt, während der Schauprozesse gegen Bucharin, wartete er tagelang darauf, ein Ticket für den Gerichtssaal zu bekommen. Ich habe bei der Recherche ein Foto gefunden, auf dem er im Publikum sitzt.
Und wieder schrieb er ein Buch, brillant formuliert, aber inhaltlich schwer erträglich: ein Text, der Stalin preist und das System rechtfertigt.
Warum war er so verblendet?
Am Anfang war es, glaube ich, die Suche nach einer absoluten Wahrheit. Er kam aus einem Land, in dem fast alles arm und schwierig war. Er suchte nach der absoluten Schönheit, der absoluten Wahrheit, auch politisch – und fand sie scheinbar im Kommunismus.
1933 glaubte er tatsächlich noch, dass in der Sowjetunion vieles gelungen sei: die Befreiung der Armen, ein Ausweg aus der Misere. 1938, denke ich, wusste er bereits, was lief. Denn während seines Aufenthalts wurde vor seinen Augen eine Freundin von ihm verhaftet, verschleppt und im Gulag zum Schweigen gebracht. Niemand weiß mit Sicherheit, wann und wo sie starb.
Trotzdem sagte er – das weiß ich von seinem dänischen Übersetzer –, wenn man nicht zu Stalin und zur Sowjetunion halte, würden die Faschisten siegen. Das war seine Logik.
Das Interessante ist ja, dass er dann mit Atomstation so etwas wie einen Sprung in die Nachkriegsmoderne geschafft hat. Eine Art politische Emanzipation: Dass man sich in einer neuen Zeit, in einer neuen Welt seine Identität immer wieder neu erkämpfen muss. Atomstation ist ja auch sein einziges Buch, das in seiner Gegenwart spielt.
Genau, es ist Gegenwartsliteratur. Das hatte er zuvor nie gemacht. Er schrieb es direkt nach der Islandglocke, als er sich wieder auf die Werte von Identität und Selbstbestimmung zurückbesann.
In den 1950er-Jahren entwickelt er sich allmählich zu einem skeptischen Humanisten, wenn man so will. Das Paradoxe ist: Während der Stalin-Zeit wurde er nie ins Russische übersetzt, obwohl er alles tat, um dort bekannt zu werden. Erst nachdem er sich innerlich von der Sowjetunion entfernt und nach Stalins Tod, wird er dort ein wichtiger Autor und in großen Auflagen publiziert.
Und dieses Abstand nehmen vom Sowjetkommunismus war deutlich – das zeigt zum Beispiel sein Protestbrief an Wilhelm Pieck wegen der Verhaftung von Walter Janka, seinem DDR-Verleger, nach den Ungarn-Protesten 1956. Janka saß fünf Jahre im Gefängnis. Laxness war darüber tief schockiert.
Aber warum er, als seine Freundin im Gulag verschwand, öffentlich schwieg – das bleibt eine der großen Fragen. Privat informierte er den isländischen Verlobten der Frau, doch das erste Mal schrieb er öffentlich darüber erst 1963. Sehr spät. Aber in seinem autobiografischen Buch von diesem Jahr, 'Zeit zu Schreiben', rechnet er mit dem Sowjetsozialismus ab.
Du hast ihn eben als skeptischen Humanisten beschrieben. Würdest du sagen, er hat sich am Ende von allen Ideologien befreit und klarer gesehen?
Man muss das sehr differenziert sehen.
Nach 1956, nach der Niederschlagung des Ungarn-Aufstands, war er eindeutig gegen die sowjetische Politik. Er trat öffentlich gegen die Invasion ein, schrieb Artikel dagegen. Aber ihm war wichtig, nicht den Weg von Arthur Koestler oder anderen Ex-Kommunisten zu gehen, die dann in den Augen vieler „auf die andere Seite“ wechselten.
Gegenüber seinen Freunden in Island und seinen politischen Gefährten im Ausland wollte er nicht als jemand erscheinen, der plötzlich den Lagerwechsel vollzieht. Diese Loyalität war ihm wichtig. Vielleicht hat er auch deshalb nie einen Roman geschrieben, der diesen Bruch so klar verarbeitet wie Koestlers Sonnenfinsternis oder Sperbers Wie eine Träne im Ozean.
In persönlichen Berichten, etwa in Briefen an seine Frau, war er sehr viel härter. In einem Brief nach einer DDR-Reise Anfang der 1960er Jahre schreibt er etwa, sein neuer Verleger Klaus Gysi sei ein schrecklicher kommunistischer Bürokrat und er werde dieses Land nie wieder betreten.
Er war sich also sehr bewusst, was passierte. Aber er wollte öffentlich nicht den typischen Weg des „abtrünnigen Kommunisten“ gehen, der dann in den Diskursen der Rechten landet. Das war für ihn eine tragische Konstellation – auch weil er in den USA als „Roter“ gebrandmarkt wurde und kaum Chancen auf große englische Übersetzungen hatte.
Das hatte ja auch konkrete Folgen für seine Karriere, oder?
Ja. Erst 1997 erschien Sein eigener Herr wieder auf Englisch, und das war der Beginn einer neuen Phase. Danach veröffentlichte Random House in rascher Folge zehn Romane von ihm. Ironisch ist: 1946 hatte Alfred Knopf, der Gründer von Random House, Sein eigener Herr im Programm – das Buch verkaufte sich 450.000 Mal, vor allem über Buchclubs. Ich war selbst zwanzig Jahre Verleger und habe nie von jemandem gehört, der nach einem solchen Erfolg sagt: Mit diesem Autor mache ich nicht weiter.
Aber genau das passierte. Das FBI mischte sich ein, Knopf wurde vorgeworfen, Laxness hätte keine Steuern bezahlt. J. Edgar Hoover schrieb persönlich einen Brief. Der politische Druck war enorm.
Wenn du heute zurückschaust: Welche Romane von Laxness werden überleben? Welche werden für unsere Gegenwart und auch für jüngere Generationen lesbar bleiben?
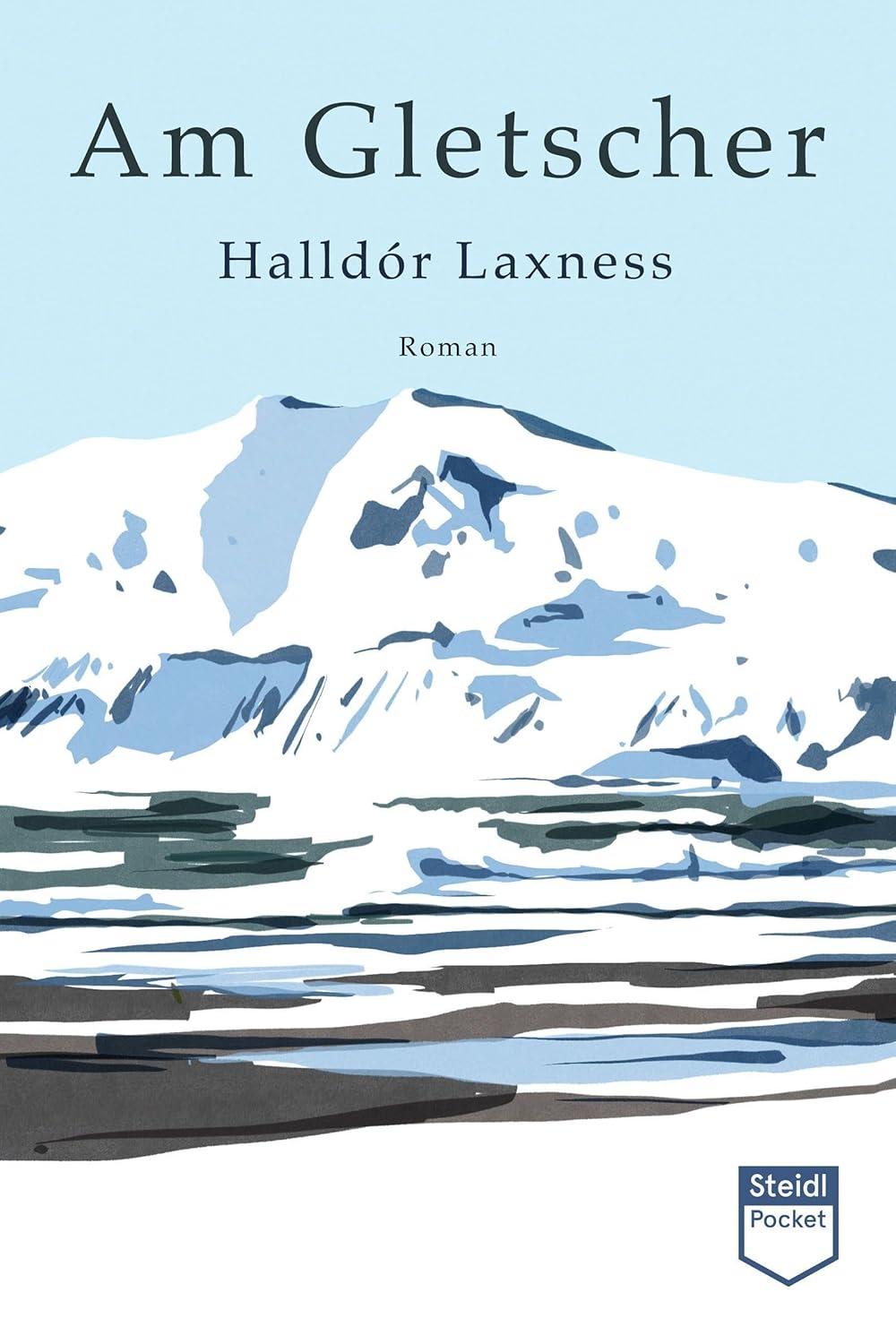 Steidl
SteidlHalldór Laxness | Am Gletscher | Steidl | 200 Seiten | 16,90 EUR
Ich glaube, es wird immer wieder Leser*innen geben, die Sein eigener Herr als großes Buch entdecken.
Ich schätze außerdem Das Fischkonzert sehr und natürlich Am Gletscher. Am Gletscher ist das modernste Buch, das er geschrieben hat.
Nach 1960/61 dachte er nämlich, niemand interessiere sich mehr für epische Geschichten. Er wollte unbedingt „en vogue“ sein, ganz vorne in der literarischen Bewegung. Das war die Zeit des absurden Theaters, des Nouveau Roman. Also schrieb er drei Theaterstücke im absurden Stil – keines von ihnen wird die Zeit überdauern.
1968 wandte er sich dann wieder dem Roman zu und schrieb Am Gletscher. Dieses Buch ist unglaublich ausgeflippt, völlig anders als alles, was er zuvor gemacht hatte, und dabei sehr komisch. Als es endlich auf Englisch erschien, schrieb Susan Sontag ihren letzten Essay darüber.
Man darf nicht vergessen, wie alt er wurde und wie sehr er die Ungleichzeitigkeit verschiedener Epochen erlebt hat. Er sitzt mit seiner Frau beim Frühstück in einem Hotel – neben ihm Janis Joplin.
Oder die Geschichte mit Che Guevara: Atomstation wurde nach dem Nobelpreis überall übersetzt, auch in Argentinien. Ein junger Arzt las das Buch dort und fragte 1961 einen isländischen Journalisten in Kuba, ob es in Island immer noch so schlimm sei, wie in Atomstation beschrieben. Dieser Arzt war Che Guevara, 1961 Chef der Zentralbank von Kuba.
Laxness wurde 1902 geboren und starb 1998. In den letzten zehn Jahren war er kaum noch wirklich in der Welt. Aber ich erinnere mich daran, ihn als Kind gesehen zu haben – er war ein Freund meiner Großeltern.
1983, ich lebte damals in Dänemark, schrieb ich über ihn und dachte: Warum ihn nicht einfach besuchen? In den Weihnachtsferien war ich ohnehin hier, und er wohnte ja ganz in der Nähe. Also ging ich hin.
Es war unglaublich. Er sagte: „Komm, wir setzen uns und rauchen.“ Es waren sehr dicke Zigarren. Er erzählte von allen möglichen Leuten, die er getroffen hatte, und von seiner Jugend. Er war gnadenlos in seinen Urteilen über andere Autoren – mit wenigen Ausnahmen: Cervantes, Dostojewski, vielleicht Hemingway.
Aber ich durfte nichts mitschreiben. Ich sollte einfach zuhören. Das Verrückte war: Ich wusste über manche Perioden seines Lebens mehr als er selbst, weil ich die Quellen studiert hatte. Aber er hatte seine eigene Geschichte bereits ein wenig neu erfunden.
Von dieser Tendenz hat auch Max Frisch geschrieben: Irgendwann erzählen alle eine Geschichte, die sie dann für ihre wahre Biografie halten.
Genau. Und diese, seine Version, erzählte er mir. Sie war phänomenal.
Am Ende sagte er: „Jetzt hast du doch ein ganz gutes Bild vom Ganzen, oder?“ Dann lud er mich später zu einem wunderbaren Abendessen ein und hatte auch mein Buch über seine frühen Werke gelesen – das fand er sehr interessant.
Ich machte mir die ganze Zeit Sorgen, betrunken zu werden, bei all dem Bier, Wein und Cognac. Er hatte einmal geschrieben, er finde betrunkene Menschen schrecklich, also dachte ich die ganze Zeit: Bloß nicht betrunken werden!
Aber wirklich gut war er damals schon nicht mehr beieinander. Seine Frau kümmerte sich um ihn, passte auf ihn auf. Wahrscheinlich war es Alzheimer. Eine kleine Anekdote zu seinem Leben noch, die ich immer wichtig finde: Wir hatten ja darüber gesprochen, dass er immer das Absolute gesucht hat. Die absolute Schönheit fand er in der Musik – in der wortlosen Kunst.
Er schrieb sechzig Bücher, um sich dieser wortlosen Kunst anzunähern. Wenn man ihn – wie damals üblich – fragte, welches Buch er auf eine einsame Insel mitnehmen würde, sagte er immer: Das Wohltemperierte Klavier von Bach.
Wenn man heute sein Haus, inzwischen ein Museum besucht, steht der Flügel sehr zentral. Und welches „Buch“ liegt darauf? Das Wohltemperierte Klavier. Seine Frau hat mir erzählt, er habe am Ende zwar keine Literatur mehr lesen können, aber Noten – die habe er noch lesen können.
Er hat also tatsächlich jenes „Buch“ mit auf eine einsame Insel, die seines Alters, genommen, von dem er Jahre zuvor gesprochen hatte.
Er ist ja sehr spät gestorben, hat alles überlebt und war am Ende so etwas wie ein Monolith der isländischen Literatur. Das muss die Literatur des Landes doch auch geprägt haben.
Sind diese Themen – die Suche nach Identität, sprachliche Selbstbehauptung, geografische und politische Selbstbeherrschung – in der heutigen isländischen Literatur noch Kernthemen? Du hast ja im letzten Jahr ein Buch veröffentlicht - Im Schatten des Vulkans: Eine literarische Reise ins Herz Islands - in dem du einen großen Bogen von den Eddas und Sagas bis in die Gegenwart schlägst.
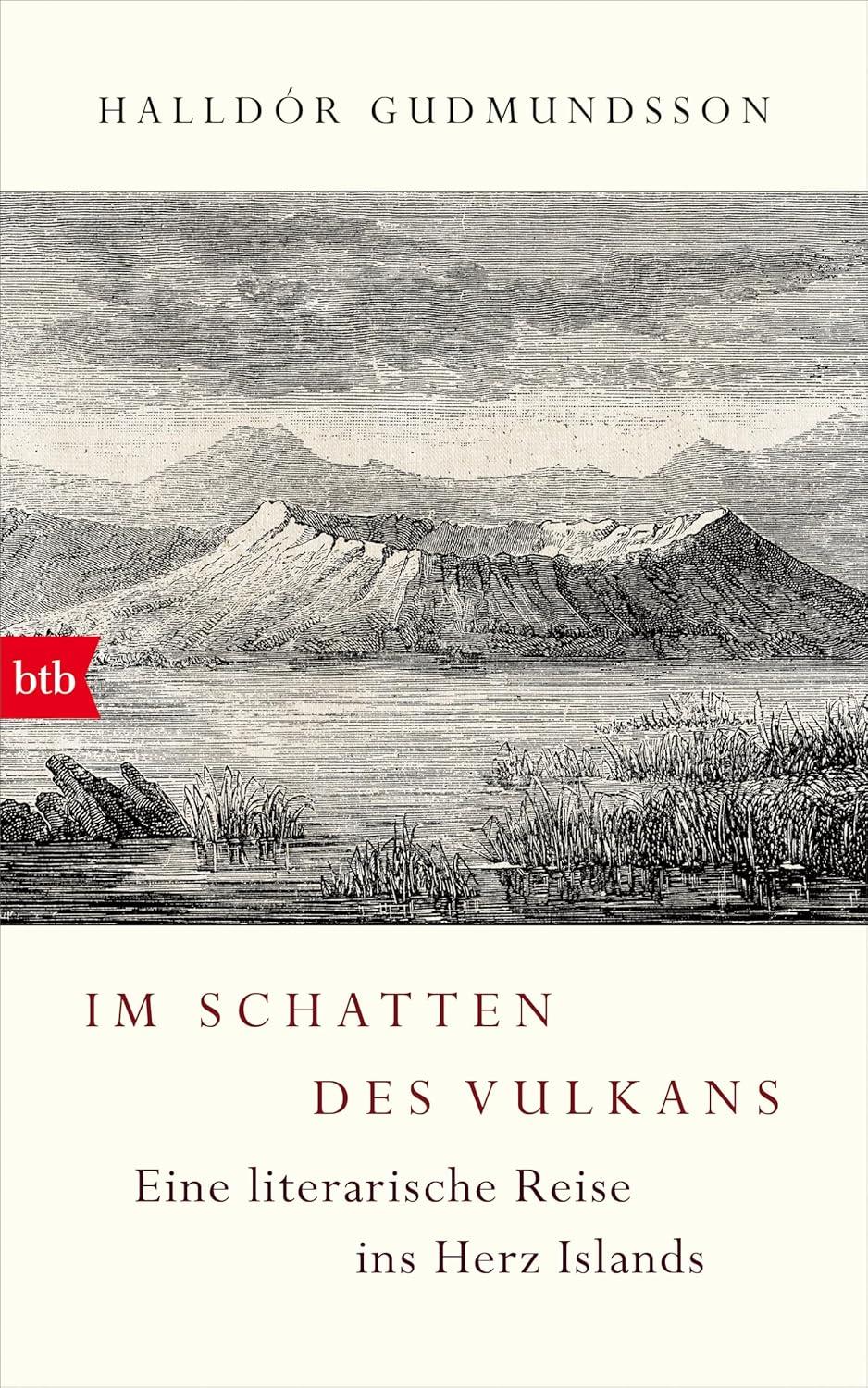 btb
btbHalldór Guðmundsson | Im Schatten des Vulkans: Eine literarische Reise ins Herz Islands | btb | 512 Seiten | 29,00 EUR
In diesem alten Sinn sind es nicht mehr die Kernthemen. Die Themen, die die jüngeren Schriftsteller*innen beschäftigen, sind im Großen und Ganzen die gleichen wie in Europa sonst auch.
Du sagst „Europa“ …
Ja. Wir sehen uns als Europäer, aber wir sind trotzdem ein bisschen weiter weg als andere Europäer. Und genau das erzeugt eine interessante Spannung.
Trotz unserer Randlage haben wir mittlerweile eine sehr lebendige Immigrationsliteratur. Rund 80.000 der 400.000 Menschen in Island haben einen Migrationshintergrund – also etwa 20 Prozent der Bevölkerung. Die allermeisten sind keine Geflüchteten, auch wenn darüber politisch gern dramatisiert wird. Die meisten sind hier, um zu arbeiten, sie schicken Geld nach Hause und bauen sich ein Leben auf. Die größte Gruppe kommt aus Polen, gleich danach aus Litauen.
Vor hundert Jahren waren vielleicht ein Prozent der Bevölkerung aus dem Ausland. Heute sind es 20 Prozent. Und ich finde es unglaublich spannend, dass aus diesem Teil der Gesellschaft nun Autor:innen hervorgehen, die auf Isländisch darüber schreiben, wer sie sind.
Die Parallelen zum globalen Süden, etwa zu den Philippinen, sind wirklich frappierend. Vor allem, weil hier auch eine Diaspora genau das tut, was vorher die selbst kolonialisierten „Eingeborenen“ so viele Jahre gemacht haben: sich erzählend verorten.
Ganz genau. Die Isländer haben immer versucht, den Kern des Lebens in Geschichten zu fassen. Wenn man einen Isländer fragt, was der Sinn des Lebens sei, fängt er in der Regel mit seinem Onkel auf den Westfjorden an – einer Anekdote, die dann alles erklären soll. Es kommt immer eine Geschichte.
Nicht anders als in der oralen Tradition vieler Kulturen im subsaharischen Afrika …
Ja. Du erzählst eine Geschichte, um dir das Leben zu erklären. Philosophie im strengen Sinn ist ein Produkt der Stadt: abstrakte Begriffe, lange deutsche Wortketten, all das. Horkheimer schreibt in einem englischen Brief einmal: „There is no thought, properly speaking, other than cities.“ So sehen Stadtphilosophen die Welt. Die Isländer waren darin nie besonders gut. Wir hatten keine großen Städte, wir hatten Höfe, kleine Orte, harte Natur. Aber man braucht dennoch Wege, mit dem Leben umzugehen.
Im Grunde gibt es zwei große Fragen: Wie findest du deinen geistigen Platz in der Welt? Und wie verlierst du dich dann nicht in dieser Welt? Also sich finden, ohne sich dabei zu verlieren.
Aus dieser Spannung entstehen Geschichten. Deshalb gibt es so viele Bücher. Und Laxness war einer jener Autoren, die uns aus unserer Verlorenheit zurückgeholt haben – so wie er selbst irgendwann aus der Welt nach Island zurückgekehrt ist.
Hat Ihnen dieser Text gefallen? Dann unterstützen Sie doch bitte unsere Arbeit einmalig oder monatlich über eins unserer Abonnements. Wir würden uns freuen!
Wollen Sie keinen Text mehr auf Literatur.Review verpassen? Dann melden Sie sich kostenlos für unseren Newsletter an!



