Anpassung und Widerstand

Rudolf Isler ist Autor, Bildungsexperte, ehemaliger Dozent und Präsident des Senats der Pädagogischen Hochschule Zürich. Davor langjährige praktische Erfahrung als Sekundar- und Mittelschullehrer. Publikationen zu historischen und aktuellen Fragen der Pädagogik, der Allgemeinen Didaktik und der Lehrberufe; Schwerpunkt: Förderung der Selbstwirksamkeit von Kindern und Jugendlichen. Biographie über Manès Sperber aus pädagogischer Perspektive und Autor und Regisseur des Dokumentarfilms Manès Sperber – ein treuer Ketzer.
Ein Blick zurück öffnet uns Fenster, gibt Zutritt in Zeit-Räume, die uns zeigen, wie massiver gesellschaftlicher Druck wirkt – Machtspiel, Anpassung, Widerstand. Drei Romane aus dem letzten Jahrhundert – Der Untertan, Sonnenfinsternis und Sansibar oder der letzte Grund – erzählen von Menschen, die mitlaufen, Angst bekommen, sich ideologisch verirren, sich wehren, aufbegehren, aufgeben. Wer ihre Geschichten wieder liest, begibt sich auf eine Spurensuche nach bedrängenden Fragen der Gegenwart, es geht um Macht und Unterwerfung, um Freiheit, Moral und Verantwortung, aber auch um Ohnmacht und Niederlagen.
Der Untertan von Heinrich Mann wurde 1914 fertiggestellt und ist 1918 erstmals erschienen. Darin entfaltet der Autor Schritt für Schritt das Seelenbild eines Menschen im deutschen Kaiserreich, der sich unterwirft, gleichzeitig aber von Macht besessen ist, eines Menschen, in dem sich die Gefolgschaft für den Kaiser und das Vaterland und die Bereitschaft, für beide in den Krieg zu ziehen, sukzessive aufbaut. Diederich Hessling, so heisst der Held, ist bereit, für seinen Kaiser zu sterben. Aber er ist nicht nur opferbereiter Untertan. So demütig er sich unterwirft, so bereit ist er, andere zu beherrschen und sie, ohne Mitgefühl, leiden zu lassen.
Schon als Kind beginnen sich die beiden Seiten seines Wesens auszubilden. Auf der ersten Seite des Romans lernen wir Diederich als kränklichen Jungen kennen, der sich vor allem fürchtet, vor eingebildeten übergrossen Kröten und Gnomen. Aber
fürchterlicher als Gnom und Kröte war der Vater, und obendrein sollte man ihn lieben. Diederich liebte ihn. Wenn er genascht oder gelogen hatte, drückte er sich so lange schmatzend und scheu wedelnd am Schreibpult umher, bis her Hessling etwas merkte und den Stock von der Wand nahm. […]
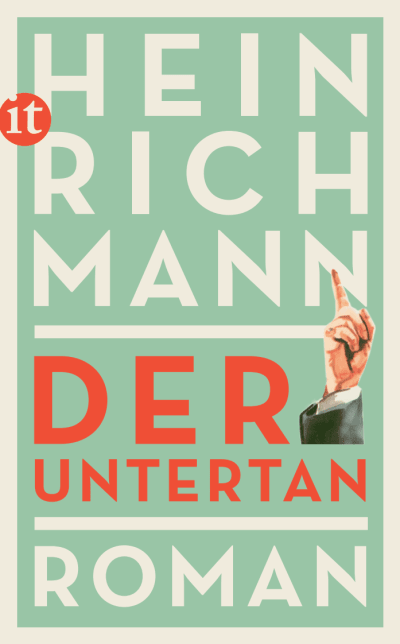 Suhrkamp Insel
Suhrkamp Insel
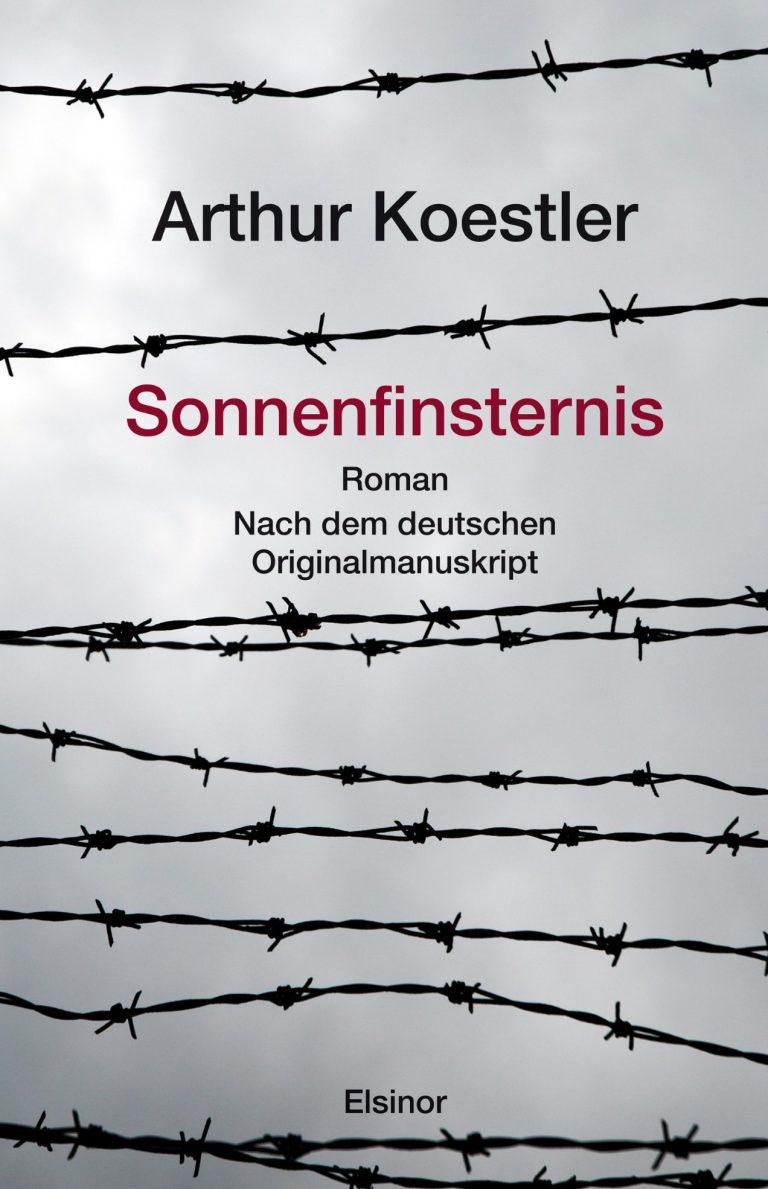 Elsinor
Elsinor
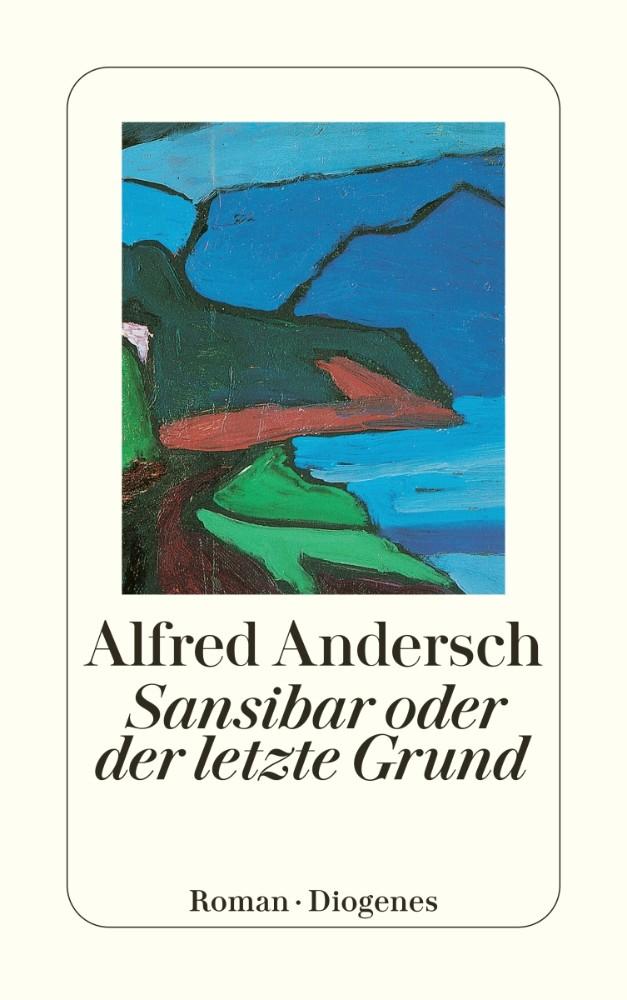 Diogenes
Diogenes
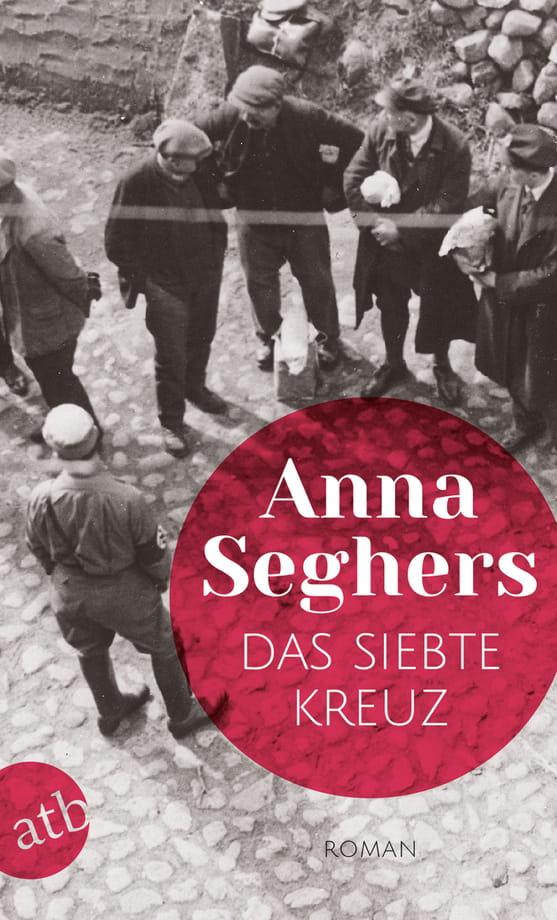 Aufbau
Aufbau
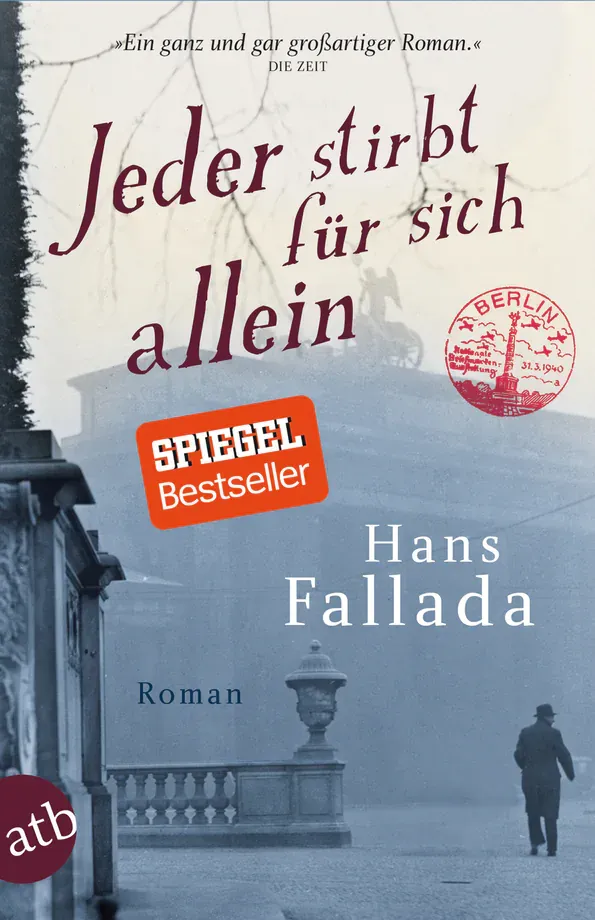 Aufbau
Aufbau
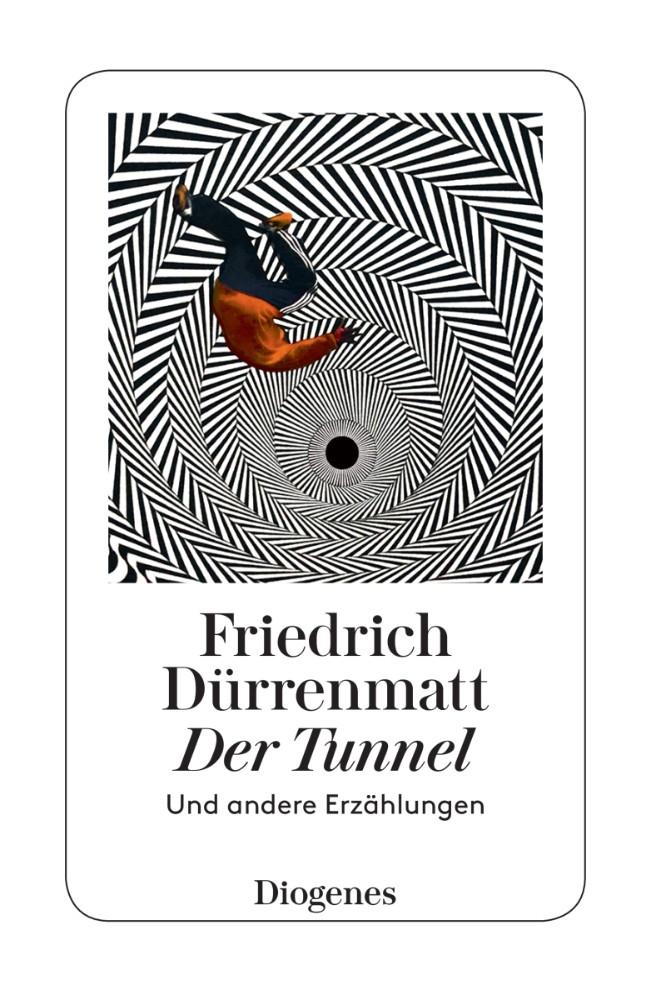 Diogenes
Diogenes
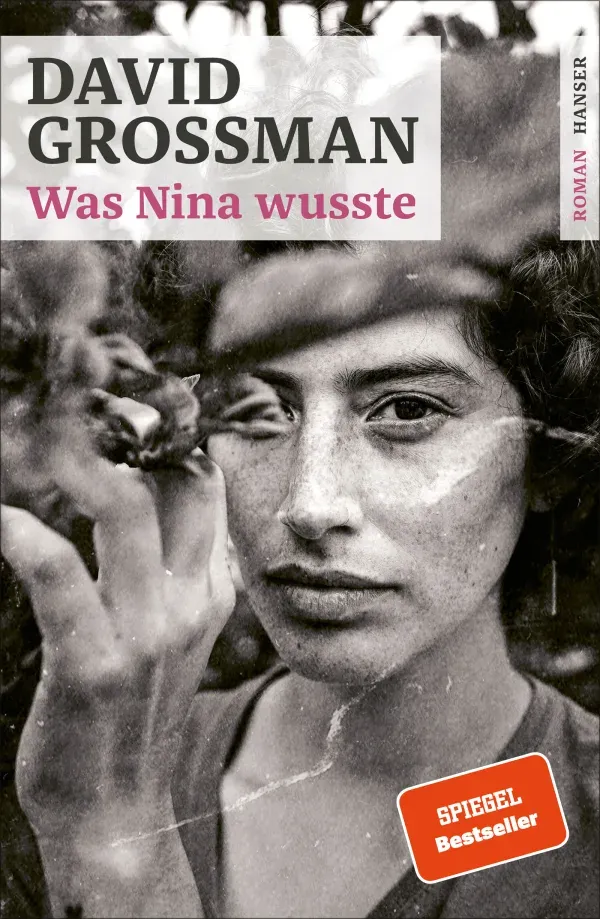 Hanser
Hanser
Wenn er nach der Abstrafung dann aber verweint und mit aufgedunsenem Gesicht an der Werkstatt des hauseigenen Betriebs vorbeikommt und die Arbeiter lachen, spielt er sich ihnen gegenüber sofort auf, streckt ihnen die Zunge heraus und ruft ihnen zu, sie wären froh, von seinem Vater Prügel erhalten zu dürfen, aber dafür seien sie zu gering. Er bewegt sich zwischen ihnen wie ein launenhafter Pascha; drohte ihnen bald, es dem Vater zu melden, dass sie sich Bier holten, …
Diederich Hessling wird zu einem von Abertausenden, die sich vor dem 1. Weltkrieg hingebungsvoll der kaiserlichen Macht unterziehen und zu deren Erfüllungsgehilfen werden. In ihnen verquicken sich Furcht vor der Macht mit einer unterwürfigen Zuneigung. Kein Zufall, dass Heinrich Mann seinen Roman mit der Kindheit des Protagonisten beginnen lässt: Diederich lernt, die Autorität des Vaters zu fürchten und gleichzeitig die kindliche Liebe und das Zutrauen zu ihm zu bewahren. So wird er seelisch darauf vorbereitet, sich jeder Macht bedingungslos zu unterwerfen, als ob er damit seiner Zuneigung entgegenkäme. Kein Zufall auch, dass Heinrich Mann als Untertitel (der leider in neueren Veröffentlichungen fehlt) Geschichte der öffentlichen Seele unter Wilhelm II gesetzt hat. Je länger man im Roman liest, desto stärker spürt man, dass der Krieg wie ein grauenhaftes, unheilvolles Unwetter auf eben diese Menschen zukommt, die ihn selbst durch ihre seelische Verfassung erst ermöglichen. Und man ist nicht fern vom Gedanken, dass nicht nur die Herrscher, sondern auch diejenigen zur Diskussion stehen, die ihnen durch ihre furchtsame Unterwerfung und liebevolle Huldigung erst die Macht verleihen.
Sonnenfinsternis von Arthur Koestler erzählt das Schicksal des Mannes N. S. Rubaschow (S. 20). Das Buch entstand 1940, erschien nach dem 2. Weltkrieg in englischer, deutscher und französischer Sprache und fand in kürzester Zeit eine halbe Million Leser. Rubaschow ist eine fiktive Figur, gemäss Koestler aus den Schicksalen einer Anzahl Männer zusammengesetzt, die Opfer der sogenannten ’Moskauer Prozesse’ wurden. Einige von ihnen waren dem Autor persönlich bekannt. Ihrem Andenken ist dieses Buch gewidmet. (S. 20)
Die Moskauer Schauprozesse der Jahre 1936 bis 1938 richteten sich gegen die altgedienten höchsten Funktionäre der Sowjetunion, allesamt Mitglieder des Zentralkomitees der kommunistischen Partei – am deutlichsten erkennbar im Romanhelden sind Karl Radek und Nikolai Bucharin. Sie alle wurden wegen irrwitziger Verbrechen angeklagt, die sie nie begangen hatten und deren Kern gemäss Anklage die Ermordung Stalins und die Beseitigung des kommunistischen Regimes gewesen sein sollte. Ob sie sich in Schauprozessen öffentlich zu den nicht begangenen Verbrechen bekannten oder ob sie, wie ein paar wenige, schwiegen, änderte nichts; sie alle wurden durch Genickschuss hingerichtet.
Am Anfang der Geschichte wird Rubaschow verhaftet. Davor träumt er jede Nacht, dass die Schergen an seine Haustüre klopfen, um ihn zu holen. Eines Morgens hält das Klopfen aber an, obwohl Rubaschow schon wach ist, und tatsächlich wird er nun geholt. Er ist nicht überrascht, er kennt, was geschieht, ja, anfänglich ist er fast beruhigt, weil die quälenden Träume vorbei sind. Verstörend – und gleichzeitig erhellend für das Verständnis ideologisch legitimierter Macht – ist jedoch die ausführliche Beschreibung von drei Verhörperioden, die nun folgt.
In ihrem Verlauf steigen in Rubaschow Erinnerungen an Situationen auf, in denen er andere verraten hat, nur weil sie leise Zweifel am politischen System hatten. Zusehends gesteht er sich ein, dass auch ihm selbst diese Zweifel nicht fremd waren. Und aus eben diesem Grund bricht er innerlich ein, verliert seine Widerstandskraft und gibt den Anschuldigungen recht, ohne dass man ihn mit körperlicher Gewalt dazu bringen müsste: Sein Glaube an die Ideologie der Partei bleibt so stark, dass er die eigenen Zweifel an der richtigen Parteilinie letztlich auch selbst als Gefahr für den finalen Triumph des Kommunismus sieht. Sein Entschluss zum Geständnis wird so zu einem letzten Dienst für die Ideale der Revolution – so wie es sein Ankläger vorgibt:
Alles kommt darauf an, dass die Partei in sich geeinigt ist, mehr als je. Sie muss aus einem Guss sein – erfüllt von blinder Disziplin, von absolutem Vertrauen. Sie und Ihre Fraktionsgenossen, Bürger Rubaschow, haben einen Riss in die Partei hineingetragen. Wenn Ihre Reue echt ist, dann müssen Sie uns jetzt helfen, den Riss zu verheilen. Ich sagte Ihnen bereits, dass dies der letzte Dienst ist, den die Partei von Ihnen verlangt. (S. 210)
Wie die Geschichte endet, ist absehbar. Rubaschow bekennt sich schuldig. Und ganz zum Schluss hört er erneut ein Klopfen, aber dieses letzte Mal sind es die Schüsse, die seinem Leben ein Ende bereiten.
Aufgrund von Koestlers Roman entstand die sogenannte Rubaschow-Hypothese: die Annahme, dass die Geständnisse der Verurteilten in den Moskauer Prozessen ohne körperliche Folter erwirkt worden seien. Die historische Forschung hat das widerlegt. Dennoch bleibt Koestlers Geschichte eines der eindringlichsten literarischen Zeugnisse von der Wirkung von Ideologien. Wegen ihrer fast religiösen Kraft hat Manès Sperber, ein Freund und Weggenosse von Koestler, moderne Ideologien als weltliche Mystizismen bezeichnet. Der Glaube an sie verwirrt auch in unserer Gegenwart die Geister und behindert das kritische Denken.
Sansibar oder der letzte Grund von Alfred Andersch ist die bekannteste der drei Geschichten. Sie war nach ihrem Erscheinen 1957 über Jahrzehnte beliebte Schullektüre und ist auch heute noch vielen vertraut. Deshalb soll hier nur der Kern der Erzählung angedeutet und das hervorgehoben werden, was ihre möglicherweise zunehmende und gleichzeitig ermutigende Aktualität betrifft.
Zur Zeit der Nationalsozialisten, die explizit im Roman nicht genannt, sondern nur als die Anderen bezeichnet werden, treffen fünf ganz unterschiedliche Menschen in einem kleinen Hafen an der Ostsee aufeinander: ein kommunistischer Fischer; eine jüdische Frau, die aus Deutschland flüchten will; ein pubertierender Junge, der aus der Enge seiner Welt ausbrechen und am liebsten bis nach Sansibar gelangen möchte, ein Pfarrer, der die Holzfigur eines lesenden Mönchs vor den Nazis in Sicherheit bringen will; schliesslich Gregor, ein kommunistischer Funktionär, der an der Partei zweifelt. Sie alle verbindet das Motiv der Flucht.
Bewegend an der Geschichte ist, wie trotz innerer Zerrissenheit und Kämpfen mit sich selbst jede der Personen bereit ist, auf ihre Art und mit unterschiedlicher Selbstgefährdung die Möglichkeit wahrzunehmen, sich gegen den Staatsterror zu wehren, sich für die Freiheit zu engagieren, anderen Menschen zu helfen. Sansibar ist ein Beispiel dafür, dass und wie Widerstand gegen totalitäre Herrschaft möglich ist, ein Buch, das letztlich mehr Mut als Angst macht. Sansibar ist einzigartig, auch als literarische Komposition, aber es steht nicht allein. Es gehört in eine Reihe von vielen, wie zum Beispiel Das siebte Kreuz von Anna Seghers aus dem Jahr 1942 oder Jeder stirbt für sich allein von Hans Fallada, geschrieben Ende 1946. Sie alle erzählen Geschichten des Widerstands, die je länger desto weniger aus der Zeit gefallen sind.
Natürlich wissen wir alle, dass die Welt der Menschen nie heil war, sie wird es auch in naher Zukunft nicht sein. Es gab hellere Perioden, aber heute sind viele tief beunruhigt und befürchten, dass das Autoritäre überhandnimmt, dass Diktatur und Krieg zerstören, was die Menschheit in mühsamen und auch leidvollen Bewegungen in der Geschichte zu schaffen versucht. Und so mögen viele auch keine Nachrichten mehr – um sich zu schützen, fast so wie der Protagonist in Dürrenmatts schrecklich-schauriger Kurzgeschichte Der Tunnel:
Ein Vierundzwanzigjähriger, fett, damit das Schreckliche hinter den Kulissen, welches er sah (das war seine Fähigkeit, vielleicht seine einzige), nicht allzu nah an ihn herankomme, der es liebte, die Löcher in seinem Fleisch, da doch gerade durch sie das Ungeheuerliche hereinströmen konnte, zu verstopfen, derart, dass er Zigarren rauchte (Ormond Brasil 10) und über seiner Brille eine zweite trug, eine Sonnenbrille und in den Ohren Wattebüschel …
Als jedoch am Ende der Geschichte der Zug sich in einem Tunnel zusehends hinabsenkt und in fürchterlichem Sturz dem Innern der Erde entgegenrast, da sind Augen des jungen Mannes zum ersten Mal weit geöffnet und die Wattebüschel lösen sich durch einen Luftzug aus seinen Ohren. Ohne Perspektive und ohne etwas tun zu können, sieht er nun mit einer gespenstischen Heiterkeit dem Grauen entgegen.
Wir aber müssen angesichts des Bösen nicht erstarren, auch wenn wir mit offenen Augen durchs Leben gehen. Denn es gibt die Literatur. Sie kann inspirieren, nicht nur Trost spenden, sondern auch Stärkung sein – und sogar zum Handeln bewegen. Die erneute Lektüre grosser politischer Erzählungen aus den letzten hundert Jahren kann dazu beitragen, sich differenzierter zu orientieren und umfassender zu verstehen, was passiert. Zwar wiederholt sich Geschichte nicht, aber es gibt unglaublich luzide literarische Texte, die unsere Vorstellungskraft und unseren Horizont erweitern, wenn wir die Gegenwart zu beurteilen versuchen. Und sie zeigen auch, wie wir handelnd der Dunkelheit begegnen können, wenn sie noch näherkommen sollte. Ja, Literatur kann sogar einen skeptischen Optimismus begründen.
Anlass meiner Reise in die Vergangenheit war ein Buch von David Grossmann: Was Nina wusste. Eine grossartige literarische Konstruktion über drei Generationen einer Familie, die in Israel lebt: Am 90. Geburtstag der Grossmutter beschliesst die Enkelin einen Film über sie zu drehen. Im Verlauf der Filmarbeiten erfährt man lesend, wie die traumatischen Erfahrungen der Grossmutter als politisch Verfolgte in Titos Jugoslawien zu Verletzungen ihrer Tochter wurden, welche die Tochter ihrerseits ungewollt der Enkelin weitergab. Die Vergangenheit wirkt über Generationen nach. Und gleichzeitig schafft sie Zugänge zur Gegenwart.
+++
Hat Ihnen dieser Text gefallen? Dann unterstützen Sie doch bitte unsere Arbeit einmalig oder monatlich über eins unserer Abonnements. Wir würden uns freuen!
Wollen Sie keinen Text mehr auf Literatur.Review verpassen? Dann melden Sie sich kostenlos für unseren Newsletter an!
Literatur (Deutsch)
Heinrich Mann – Der Untertan. Berlin: Suhrkamp Insel 2021. 1914 fertiggestellt, 1918 zum ersten Mal erschienen.
Arthur Koestler – Sonnenfinsternis. Coesfeld: Elsinor 2017. 1940 fertiggestellt, neue Ausgabe nach dem wiederentdeckten deutschen Originalmanuskript.
Alfred Andersch – Sansibar oder der letzte Grund. Zürich: Diogenes 1970. Erstveröffentlichung: 1957.
Anna Seghers – Das siebte Kreuz. Berlin: Aufbau 2018. Erstveröffentlichung 1942.
Hans Fallada – Jeder stirbt für sich allein. Berlin: Aufbau Taschenbuch 2012. Erstveröffentlichung 1947
Friedrich Dürrenmatt – Der Tunnel. Zürich: Diogenes 2021. Erstveröffentlichung 1952, Neufassung 1978.
David Grossmann – Was Nina wusste. München: Carl Hanser 2020.



