Von der Einzigartigkeit der Europäischen Union

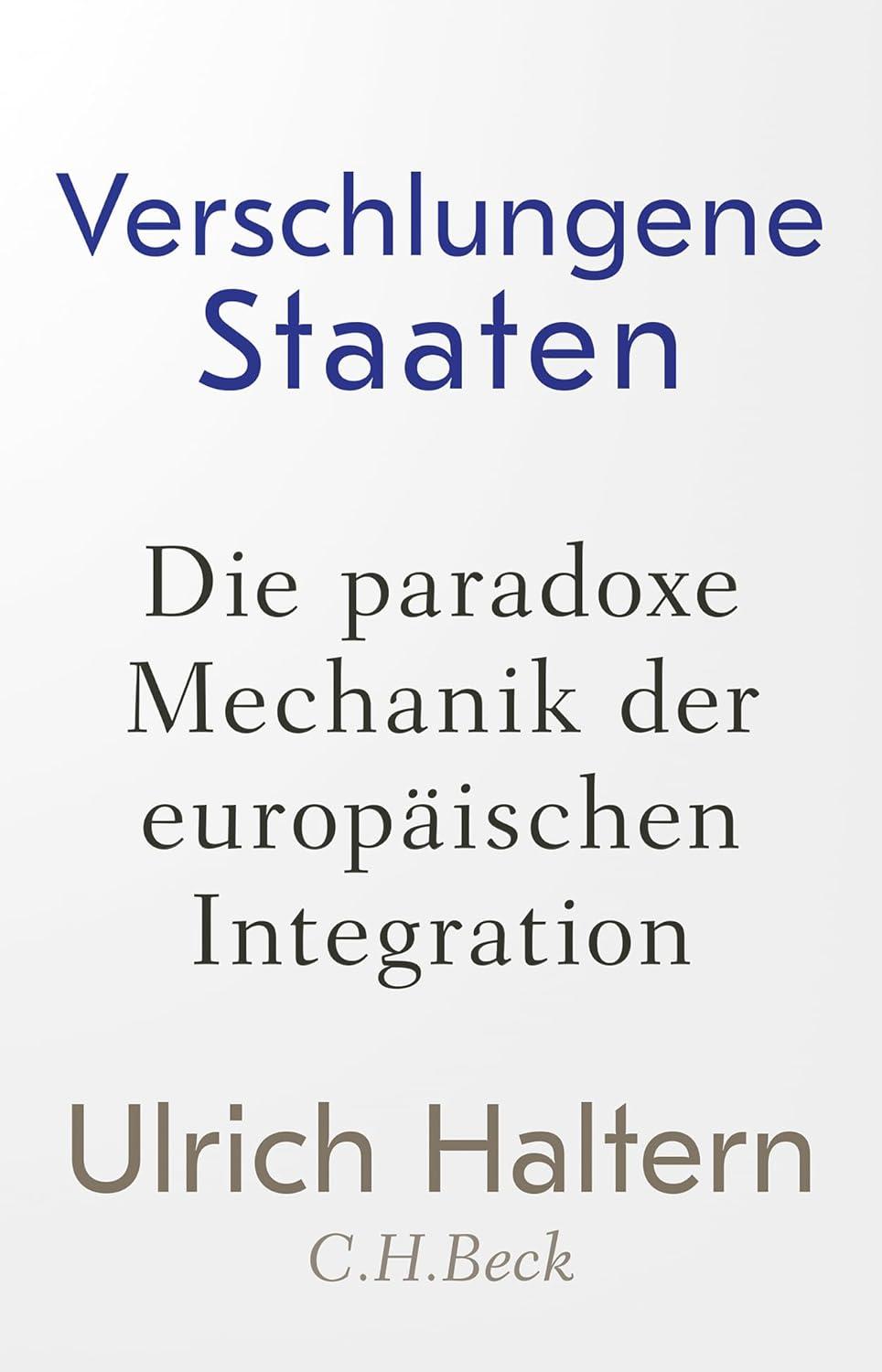 C.H. Beck
C.H. BeckUlrich Haltern | Verschlungene Staaten: Die paradoxe Mechanik der europäischen Integration | C.H. Beck | 303 Seiten | 38 EUR
Im Herbst 2024 sandte mir der Verlag C. H. Beck seine Liste der Neuerscheinungen für 2025 zu. Als jemand, für den ein föderaler europäischer Bundesstaat seit mehr als einem Vierteljahrhundert das Minimum für eine europäische Selbstbehauptung im 21. Jahrhundert darstellt, konnte ich das Buch Verschlungene Staaten: Die paradoxe Mechanik der europäischen Integration von Ulrich Haltern, nicht ignorieren. Ulrich Haltern ist Professor für Öffentliches Recht, Europarecht und Rechtsphilosophie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Er hat viele Bücher geschrieben, unter anderem auch ein mehrbändiges Standardwerk über Europarecht. Ich bin kein Jurist. Also fragte ich den Verlag, ob das neue Buch des Rechtsprofessors auch für Nicht-Juristen lesbar ist. Man beschied mir: Ja, natürlich.
Die Antwort hätte „jein“ lauten müssen. Als gelernter Historiker, der seine Magisterarbeit über die Anfänge der europäischen Integration geschrieben hat, habe ich die Entwicklung der Europäischen Union bisher immer historisch-politisch betrachtet. Die juristische Seite habe ich mir nie ernsthaft angeschaut. Ulrich Haltern hat mich eines Besseren belehrt. Er hat mir klar gemacht, dass die Europäische Union vor allem und zuallererst eine Rechtsunion ist. Eigentlich liegt dies auf der Hand, denn dieser Umstand liegt daran, dass den EU-Europäern nach wie vor weitgehend das Bewusstsein fehlt, dass sie nicht nur geografisch-kulturell, sondern auch historisch-politisch eine Einheit sind – oder wenigstens sein könnten. Wenn sie es denn nur wollten. Deshalb sind Recht und Rechtsprechung die wichtigsten Grundlagen der EU.
Das Buch hat sicher eine lange Vorgeschichte und Ausarbeitungszeit hinter sich. Die Einleitung aber geht auf die aktuelle weltpolitische Situation ein. Das fünfte Wort dieser Einleitung heißt Donald, das sechste Trump. Von Klimakrise, Flüchtlingsströmen, Pandemiefolgen und Technologiewandel ist die Rede, vom weltpolitischen Stühlerücken und dem Zerbröseln der Pax Americana sowie der europäischen Friedensordnung. Und vom Zeichnen neuer Landkarten, die Interessensphären der Großmächte widerspiegeln. Hier regte sich gleich mein Widerspruch, aber es sollte der einzige bleiben. Für mich ist die globale Neuverteilung der Macht auf unserem Planeten weit mehr als nur ein Stühlerücken, der Klimawandel weit mehr als nur eine Krise. Und die Pax Americana sehe ich schon seit zehn Jahren als etwas Vergangenes an. Auch wenn wir Europäer es in unserer Gesamtheit nicht sehen wollten. Erst seitdem uns Donald Trump den atomaren Schutzschild der USA über Nacht weggezogen hat, beginnt ein langsames Erwachen aus süßem Schlaf.
Ulrich Haltern stellt zurecht fest, dass geopolitische Erwägungen dem Nachdenken der Europäischen Union über sich selbst im Ganzen fremd geblieben sind, und dass die EU kein überzeugendes Narrativ besitzt, das über die reine Nützlichkeit hinausgeht. Wir können als Franzosen, Deutsche, Belgier, Italiener, Polen usw. mit voller Lust und Inbrunst über die schlechte nationale Politik und schlechte Regierungen schimpfen, die Existenzberechtigung unserer Vaterländer würden wir nie in Frage stellen. Bei der Europäischen Union ist das anders. Ein Mutterland Europa gibt es bis heute nicht. Die EU muss sich immer wieder über ihre Nützlichkeit für die Gesamtheit ihrer Staaten und Bürger beweisen, damit sie anerkannt wird. Dies zeigt der Autor in allen seinen Kapiteln immer wieder in großer Klarheit.
Ulrich Haltern untersucht in vier Kapiteln die Grundlagen, die Konstitutionalisierung, die Regulierung und die Effektuierung (so nennt ein Jurist die praktische Anwendung des Rechts) unter dem Aspekt des Rechts, der Politik und der Kultur, und zwar historisch und in der aktuellen Fassung. Dieser breite Ansatz, auch wenn er für Nicht-Juristen mitunter zu sehr ins Detail geht, kennzeichnet die Stärke dieses Buches. Er betont immer wieder die Lücke zwischen Herrschaftsmacht und Herrschaftslegitimation, „weil Regulierungsmacht mit weniger Legitimationsressourcen auskommt als Umverteilungsmacht“. Er arbeitet in aller Klarheit heraus, wo die demokratischen Defizite der EU liegen.
Grundsätzlich ergibt sich die Lücke daraus, dass das Individuum in einer größeren Einheit ein kleineres Gewicht hat, dass die Bürger keinen „Einfluss auf eine irgendwie geartete <Regierung> … besitzen“, dass die Wahlen zum Europäischen Parlament (EP) nicht als europäische Wahlen ernst genommen werden, weil eine europäische Identität weitgehend fehlt und dass die Wählerrepräsentation im EP verzerrt ist, weil dort die kleineren Staaten mit weniger Stimmen als die größeren einen Abgeordnetensitz gewinnen können. Hinzu kommt, dass das EP weder ein legislatives Initiativrecht noch das alleinige Budgetrecht besitzt.
Zwei Stränge bestimmen die Politik der europäischen Integration: der nationale Rechtsstrang und der europäische Rechtsstrang. Beide sind in einer Doppelhelix aufs Engste verbunden. Dieses schöne Bild impliziert auch, dass sich die beiden Stränge nicht direkt berühren. Die Interaktion findet im Zwischenraum statt. Dort vollzieht sich ein Spiel und ein Kampf zwischen nationalen, intergouvernementalen und supranationalen Rechtsordnungen. Ulrich Haltern nennt ihn den „crowded space“. Es ist ein enger Raum, der von vielen Positionen besetzt ist. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) versteht es seit einem grundlegenden Urteil aus dem Jahr 1963, die überstaatlichen Rechte beinahe ständig zu erweitern, als ein niederländisches Transportunternehmen die Rücknahme überhöhter nationaler Importzölle vor dem EuGH durchsetzte. Die Mitgliedstaaten haben das oft einfach nur hingenommen, aber genauso oft auch ausdrücklich akzeptiert oder sogar eingefordert, weil es die Funktionalität und den gemeinsamen Nutzen innerhalb der Staatengemeinschaft in der Regel erhöht hat.
Spannungsverhältnisse und Ambivalenz sind die Schlüsselwörter dieses Zustands. Die Folge ist oft, so Ulrich Haltern, dass es auf der EU-Ebene zu einer „policy without politics“ und auf der Ebene der Mitgliedstaaten zu „politics without policy“ kommt. Das verstehe ich so, dass die EU sehr oft den Rahmen einer Politik setzt, aber nicht über den vollen demokratischen Unterbau verfügt, während die Mitgliedstaaten über diesen verfügen, jedoch den Rahmen nicht mehr bestimmen können.
*Vgl. die Rezension auf L.iteratur.Review zu Robert Menasses Die Welt von morgen: Ein souveränes demokratisches Europa – und seine Feinde)
Die Entwicklung des europäischen Rechts und der aktuelle Stand der Funktionsmechanik der Europäischen Union zeigen überdeutlich auf, dass der offiziell angestrebte „immer engere Zusammenschluss der europäischen Völker“ (aus der Präambel des aktuell gültigen Lissabon-Vertrages) an eine Hürde gelangt ist, deren Überspringen eine endgültige Aufgabe der nationalen Souveränität und ein Aufgehen der Nationalstaaten in einem föderalen Bundesstaat bedeuten würde. Weil dafür das entscheidende Narrativ fehlt, weil weder die Nationalstaaten noch große Teile der europäischen Bevölkerung dies wollen, zweifelt der Autor, ob dies gelingen wird.* Dennoch ist er nicht ohne Hoffnung. Die Ablösung der letzten Restbestände des Vetorechts wird bereits diskutiert. Der Binnenmarkt und seine Ausgestaltung ist bis heute der Kern der europäischen Integration, in der das Vetorecht einzelner Mitgliedstaaten nicht mehr existiert. Dennoch gab es in der Finanzkrise und der Covid-Krise Maßnahmen (z. B. den Stabilitätsfonds), die vorher nicht vorstellbar waren. Die Notwendigkeit, die europäische Verteidigungsfähigkeit neu zu entwickeln, wird wegen des russischen Neoimperialismus intensiv diskutiert.
Für den Juristen Haltern ist die Rechtsgemeinschaft EU etwas Einzigartiges. In seiner Einleitung schreibt er: „Zudem sieht es wie eine Ironie der Geschichte aus, dass die hochmoderne europäische Integration, die die verstaubten völkerrechtlichen Mechanismen und Ideen hinter sich gelassen hat, nun durch den Einbruch atavistischer politischer Gewalt vor sich hergetrieben wird.“ Ein Scheitern der EU ist möglich. Sie, die Mitgliedstaaten und die europäischen Bürger müssen die Kraft finden, eine europäische Identität als Grundlage ihrer Staatlichkeit zu etablieren. Diesen Weg nicht zu bestreiten, käme wahrscheinlich einer europäischen Selbstaufgabe gleich. Die Verhältnisse verlangen, dass die EU auch die „power of the purse“ und die „power of the sword“ bekommt, das heißt die Verfügungsgewalt über die eigene Finanzierung sowie über die äußere und innere Sicherheit. Über den Weg dahin kann man trefflich streiten. Muss sich zuerst eine europäische Identität entwickeln oder zuerst ein föderaler Bundesstaat, in dem sich dann eine europäische Identität ausbildet? Das ist wie die Frage nach der Henne und dem Ei. Nur eines ist klar: So wie die Europäische Union im Moment aufgestellt ist, wird sie die Zukunft nicht meistern können.



