Traumaland ist überall

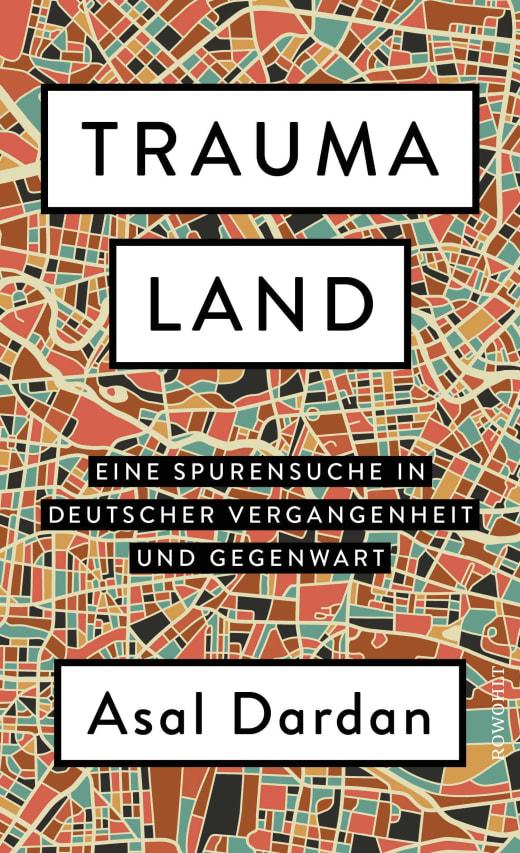 Rowohlt
RowohltAsal Dardan | Traumaland | Rowohlt | 288 Seiten | 24 EUR
Asal Dardan, 1978 in Teheran geboren, kam mit ihren Eltern nach Deutschland, da war sie etwa ein Jahr alt. Sie studierte Kulturwissenschaft und Nahoststudien, gewann 2020 mit ihrem Text Neue Jahre den Caroline-Schlegel-Preis für Essayistik. 2021 erschien ihr Essayband Betrachtungen einer Barbarin, in dem sie ihre Erfahrungen als Migrantin reflektiert.
Ihr neues Buch Traumaland erschien am 28. Januar. 2025 Die Autorin seziert in ihm die Erinnerungskultur bzw. auch die ausdrückliche Nicht-Erinnerung zur Judenvernichtung während der Nazidiktatur und zu den zahlreichen Morden an Migranten in Deutschland, vor allem nach der Wiedervereinigung 1990. Sie wehrt sich gegen das Vergessen und sie wehrt sich auch dagegen, die Individualität von Opfern von Gewaltverbrechen, seien es Migranten nach dem Zweiten Weltkrieg oder Juden während der Nazidiktatur, in abstrakten Zusammenhängen so weit zu verdünnen, dass von den einzelnen Personen nicht mehr viel übrigbleibt. Sie sucht im Geschehenen nach Mustern und Ursachen und hinterfragt die Formen der öffentlich inszenierten Erinnerung. Ich benutze das Wort Judenvernichtung und nicht Holocaust. Denn das Wort Holocaust errichtet im Deutschen schon eine Sprach-Barriere, die das Unerträgliche und die Verantwortung dafür ein Stück weit wegschiebt.
Fast immer kann ich ihr zustimmen, aber manchmal sieht sie auch nur das, was sie sehen will, und nicht das, was ist, aber dazu später mehr. Asal Dardan stellt sich am Beispiel Deutschlands selbst viele Fragen, wie man diese Welt (es ist ja nicht nur Deutschland, die Gewalt nimmt aktuell überall in erschreckendem Maße zu) voller Gewalt ertragen kann und wie man sich der Opfer erinnern sollte. Mein Eindruck dabei ist: Es ist ein Tasten, ein Forschen, ein Verarbeiten des eigenen Wissens nach außen für den Leser, aber auch nach innen, ins eigene Ich, um dem Wissen, das sie erworben und den Erfahrungen, die sie gemacht hat, auch selbst standhalten zu können.
Als ich begann, das Buch zu lesen, fiel mir wieder ein Schockmoment ein, den ich als Assistent eines grünen Abgeordneten im Bayerischen Landtag erlebt hatte. Ich ging, es mag 1998 gewesen sein, in die Pressestelle der Fraktion und sah an der Tür ein großes Plakat mit den Namen in Deutschland getöteter Migranten. Es waren über hundert. So klar hatte ich mir das noch nie vor Augen gehalten. Ich blieb wie vom Schlag getroffen stehen.
Asal Dardan startet mit einem Prolog. Er beginnt mit dem Satz „Das Blut nicht wegwischen können, nicht tilgen können, dass es geflossen ist.“ Und dieser erste Absatz endet so: „Ich laufe in der Zeit auf und ab, suche die rote Spur. Ich frage mich, was geht über die Anklage hinaus, was kommt nach ihr?“ Eine definitive Antwort gibt es nicht, diese muss jeder Leser für sich selbst suchen und finden. Aber die Autorin gibt uns bei dieser Suche zahlreiche Hilfestellungen über die Fakten hinaus. Das Buch ist eine wahre Fundgrube, gespickt mit Zitaten und Verweisen auf andere Autoren, die sich mit dem Thema (im weitesten Sinn) befasst haben. Jeder, der sich mit den Themen Judenvernichtung und Gewalt gegen Migranten befassen will, finden hier jede und jeden, der dazu kluge Dinge gesagt hat. Ich habe bei der Lektüre nur ein einziges Buch vermisst: „Masse und Macht“ von Elias Canetti. Dieser Literaturnobelpreisträger schrieb wie Asal Dardan auf Deutsch, obwohl es nicht seine Muttersprache war.
Im ersten und wohl längsten Kapitel, es heißt „Berlin“ (ein Inhaltsverzeichnis fehlt leider), geht es darum, wie im öffentlichen Raum Gedenken inszeniert wird und wie man (wir, ich, die Autorin) damit umgeht. Die Stolpersteine in vielen deutschen Städten, die an jüdische Menschen erinnern, wurden zuerst in Berlin verlegt. Asal Dardan geht ihnen nach, denn sie begegnen ihr auf Schritt und Tritt, wenn sie durch die Stadt geht, in der sie wohnt. Sie zitiert Hannah Arendt (ihr wurde 1937 die deutsche Staatsbürgerschaft entzogen), die sagte, dass das persönliche Problem der Judenverfolgung in erster Linie nicht das war, was die Feinde taten, sondern was die Freunde taten. Dasselbe gilt für die Angriffe und Hetzjagden auf Arbeitskollegen und ihre Familien 1991 in Hoyerswerda auf mosambikanische Vertragsarbeiter, die noch vom kommunistischen Ostdeutschland angeworben worden waren (siehe dazu auch die Rezension Auch die Sprache ist eine Waffe).
Sie fragt sich, weil sie es nicht begreifen kann, wie Menschen auf die Idee kommen, anderen Menschen ihr Menschsein so abzusprechen, dass sie zuletzt als Untermenschen eingeordnet werden oder ihnen das Menschsein sogar ganz genommen wird (siehe dazu auch die Rezension Die Sklaverei ist nicht in der Welt, sie ist in uns).
Ab dem zweiten Kapitel, „Köln“, der Stadt in der die Autorin aufgewachsen ist, geht es verstärkt um die Schicksale von Migranten. Dass sie mehr als einen Kulturraum aus eigener Anschauung überblicken kann, ist neben ihrer intellektuellen Neugierde meines Erachtens ein wichtiger Pluspunkt für ihre Sicht auf unsere deutsche Vergangenheit und Gegenwart. Ich selbst bin der Ansicht, dass man sein eigenes Land erst richtig kennenlernt, wenn man es einmal für eine längere Zeit verlassen hat. In meinem Fall heißt das: Von Januar 1985 bis Juni 1987 war ich Leiter einer Handweberinnen-Kooperative im ländlichen Tschad. Seit 2005 wohne ich mit meiner zweiten Frau in Brüssel.
Sie stammt aus Mauritius. Ein Augenarzt in München, mit dem sie im Altenheim vertrauensvoll zusammengearbeitet hatte, diagnostizierte im Jahr 2000 bei ihr den Grauen Star, der unbehandelt zu Blindheit führt, meinte dann aber, dass „People of Colour“ (der Arzt benutzte das damals in Bayern übliche „N-Wort“) das eben hätten und sie deshalb keine Medikamente nehmen müsste. Sie hat 1996 in München in vier Wochen mehr Rassismus erlebt als in zehn Jahren in Stuttgart. Warum erzähle ich das? Zum einen wegen des verschärften Blicks, den man bekommt, wenn man mehr kennt als das eigene Land, zum anderen weil ich aus eigenen Erfahrungen bestätigen kann, was Asal Dardan beschreibt und bewertet.
Was es heißt in und mit einem bedrohten Körper zu leben, das ist das Thema im Kapitel „Dessau“. In dieser Stadt wurden drei schreckliche Morde verübt. Bei einem waren höchstwahrscheinlich ein oder mehrere Polizisten der bzw. die Täter. Wie schon im Kapitel „Köln“, in dem die Morde des Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU) schon eine Rolle spielten, hören wir noch einmal wie wenig Schutz oft von denen kommt, die im Auftrag des Staates dafür da sind, Schutz und Sicherheit zu garantieren bzw. Übergriffe bis hin zum Mord, klar zu ermitteln und deutlich zu bestrafen.
Das letzte Kapitel heißt „Hoyerswerda“. Ich staunte nicht schlecht, als ich es las. Erwartet hatte ich, dass es um die schon erwähnten rassistischen Angriffe in dieser Stadt im Jahr 1991 ging. Ich studierte in dieser Zeit Geschichte in Heidelberg. Durch einen Zufall bin ich bei einem freien Kameramann als Tonmann eingesprungen, der in Hoyerswerda Einwohner zu den Ausschreitungen interviewte, um Einspieler für eine aktuelle Brennpunkt-Sendung im Ersten Deutschen Fernsehen (ARD) zu generieren. Zwei Drittel der befragten Menschen standen ohne Wenn und Aber hinter den Ausschreitungen und befürworteten diese ohne jede Scham, ohne geringste Anzeichen eines Unrechtsbewusstseins.
In „Hoyerswerda“ geht es aber vor allem um das Jugendbuch Krabat, das Otfried Preußler geschrieben hat und das im Umland von Hoyerswerda spielt. An diesem Text will die Autorin beweisen, wenn ich sie richtig verstanden habe, dass alle deutschen Kinder in der nationalsozialistischen Tradition während der Diktatur aber auch noch lange danach erzogen worden sind. Das ist sicher richtig für Kindergärten und Schulen während der Diktatur, aber auf keinen Fall für die Erziehungsmethoden aller Eltern. Sie spricht, nicht zum ersten Mal, von „Schwarzer Pädagogik“. Hier liegt sie meines Erachtens falsch. In Wikipedia kann man lesen, dass das Konzept „Schwarze Pädagogik“ (ich kannte diesen Begriff gar nicht) in der pädagogischen Fachwelt stark angezweifelt wird. Es sollen Eltern sein, die ihre Kinder auf totale Unterwerfung trimmen. Es mag einige wenige psychisch kranke Eltern geben, die so handeln, aber diese Pädagogik als allgemeines Muster in Deutschland hinzustellen, kann ich nicht nachvollziehen. Es ist ein Beispiel dafür, wie ich zu Beginn sagte, dass Asal Dardan manchmal das sieht, was sie sehen will.
Es ist ihr im Übrigen ein Fehler unterlaufen. Die Geschichte des Waisenjungen Krabat, der als Lehrjunge in die Mühle eines Hexenmeisters gerät, spielt nicht im 30-jährigen Krieg (17. Jh.) wie sie es mehrmals sagt und auch für ihre Argumentation benutzt, sondern im Großen Nordischen Krieg (18. Jh.), an dessen Ende der Aufstieg Russlands mit dem Sieg Peters des Großen über die Schweden bei Poltawa beginnt. August der Starke, Kurfürst von Sachsen und zugleich König von Polen, nimmt mit seinen Ländern an diesem Krieg teil. Auch die zweite Belagerung Wiens durch die Türken kommt im Buch vor, weil der Hexenmeister den Müllergesellen, eine Geschichte aus seiner Jugend erzählt, die sich im Lager der türkischen Armee vor Wien abspielt. Im Buch besucht August der Starke (der Name wird in der Geschichte nicht genannt) durch Zufall die Mühle und zerreißt ein Hufeisen, um allen zu zeigen, wie stark er ist.
Krabat ist eine Geschichte, in der das Böse durch die Liebe besiegt wird. Nachdem der Müllergeselle Krabat durch „sein“ Mädchen befreit wird, muss der Hexenmeister sterben und die Müllergesellen verlieren ihre Zauberkräfte. Das Paar verlässt gemeinsam die Mühle. Dabei fällt Schnee „wie Mehl“. Es ist der letzte Satz des Buches. Daraus konstruiert die Autorin, dass das Mehl nicht für Mehl steht, sondern für das menschliche Knochenmehl, das die Müllerburschen einmal im Monat für den Teufel mahlen mussten, ob sie wollten oder nicht. Wie gesagt, in diesem Punkt kann ich ihrer Argumentation nicht folgen.
Die Autorin stellt sich selbst an einer Stelle die Frage, ob ihr Fokus auf die deutsche Gewaltgeschichte nicht schon zu spät kommt. Sie spielt damit wahrscheinlich auf die Weltlage an, die von immer mehr Kriegen geprägt wird und vielleicht auch auf die in Deutschland steigenden Gewalttaten durch Migranten. Aber Traumaland ist ein wichtiges Buch. Einfach, weil es wichtig ist, sich immer wieder mit der Geschichte seines Landes auseinanderzusetzen. Jedes Land sollte dies tun, aber weder jeder Staat noch jeder Mensch ist dazu in der Lage. Auch mir fiel es manchmal schwer „Traumaland“ zu lesen, kann ich doch bis heute nicht einmal den Film „Schindlers Liste“ anschauen, weil ich mich in meiner Jugend und jungen Erwachsenenzeit so intensiv mit der Judenvernichtung beschäftigt habe, dass ich dazu emotional nicht mehr fähig bin. Aber ich bin der Autorin dankbar für ihre Zusammenstellung zahlreicher Fakten über Gewalt gegen Migranten in Deutschland und ihr Nachdenken darüber, warum es so weit kommen konnte.
Wir Deutschen galten weltweit immer als besonders gründlich. Das waren wir auch im Bösen, das es überall gibt. Es waren Deutsche, die Menschen zum ersten Mal industriell verwertet haben. Meine Mutter, deren beste Freundin in ihrer Schulzeit eine Jüdin war, die von einem Tag auf den anderen plötzlich verschwand, ist ausgeflippt, als ich sie als 17-Jähriger fragte: „Habt ihr gewusst, dass die Seife, die ihr benutzt habt, aus Juden hergestellt worden ist?“ So etwas ist geschehen. Doch solche Weltmeister wollen wir nie wieder werden.



