China (und uns) besser verstehen

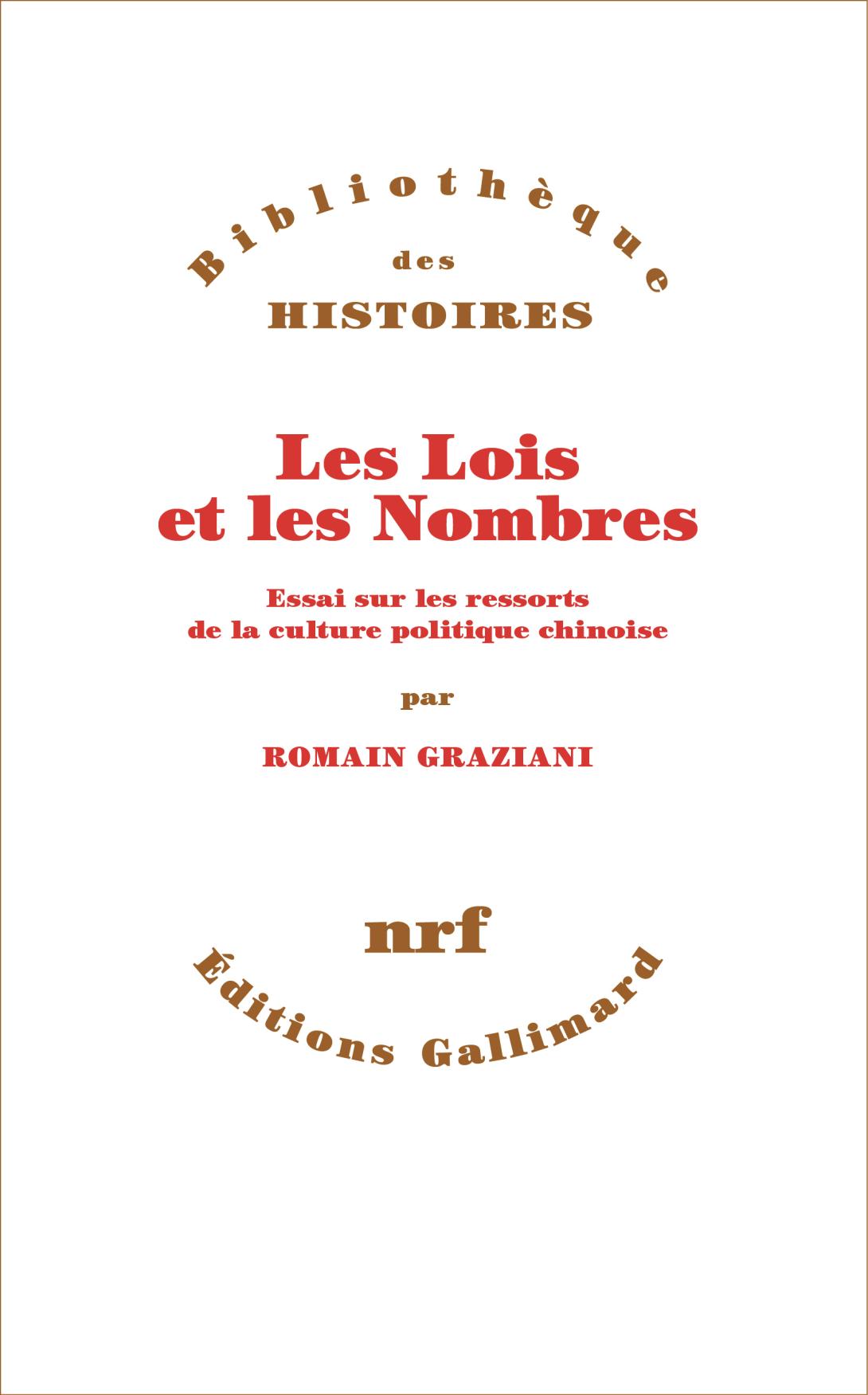 Gallimard
GallimardRomain Graziani | Les Lois et les Nombres – Essai sur les ressorts de la culture politique chinoise | Gallimard | 512 Seiten | 24 EUR
Romain Graziani ist ein französischer Sinologe, Universitätsprofessor, Philosoph, Dichter und Schriftsteller. Sein Buch Les Lois et les Nombres – Essai sur les ressorts de la culture politique chinoise ist 2025 bei Gallimard erschienen. Den französischen Begriff les ressorts kann man mit Wurzeln übersetzen, die ein Symbol sind für dem Auge verborgene Energien und Kräfte. Das ist hier durchaus wörtlich zu nehmen, denn der Autor arbeitet sich durch Texte, die chinesische Archäologen erst in den letzten Jahrzehnten gefunden haben. In einem Gespräch auf Youtube sagt Graziani, er habe ein Buch von 500 Seiten geschrieben, um die Dinge einfach zu machen. Ein schöner Hinweis darauf, dass sein vorgelegtes Werk sehr dicht und komplex ist.
Romain Graziani schreibt zu Beginn seines Buches, dass man bei allem, was folgt, immer das Buch Die Kunst des Krieges von Sun Tzu (Sunzi) mitdenken müsse. Es soll um 500 vor unserer Zeitrechnung (v.u.Z.) geschrieben worden sein und gilt bis heute als eines der wichtigsten Bücher, die je über den Krieg geschrieben worden sind. Es ist u.a. auf Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch und Arabisch erschienen. Sun Tzu beschreibt als erster, dass derjenige den Krieg gewinnt, der alle verfügbaren Daten am genauesten analysiert und das so gewonnene Wissen skrupellos einsetzt. Sein Ideal ist es, einen Krieg gar nicht erst führen zu müssen, sondern ihn möglichst schon im Vorfeld zu entscheiden. Um dieses Ziel zu erreichen, ist ihm jedes Mittel recht. Es gibt keine moralische Grenze, die er dafür nicht überschreiten würde.
Der älteste Slogan der Welt
Das erste von insgesamt acht Kapiteln heißt Der älteste Slogan der Welt. Er lautet: Bereichere den Staat, stärke die Armee. Diese Forderung wird zum ersten Mal von Shang Yang erhoben. Er gilt als der erste der sogenannten Legalisten (er stirbt 338 v.u.Z.). Seine Lehren wurde im Buch des Prinzen Shang weitergegeben und weiter entwickelt. Es ist wahrscheinlich, dass Shang Yang nicht der alleinige Verfasser des Buches war.
Die Legalisten waren Staatstheoretiker und fast immer in führenden Positionen tätig. Sie sind Vordenker und Vertreter einer grundlegenden Revolution, die versuchten einen Ausweg aus dem jahrhundertelangen Chaos der Streitenden Reiche (481 – 221 v.u.Z) zu finden. Ihr Ansatz: Politik benötigt Instrumente, um erfolgreich zu sein. Die Persönlichkeit des Herrschers allein, der oft genug seinen Aufgaben nicht wirklich gewachsen ist, genügt nicht. Man braucht Gesetze und Institutionen, die wie eine gut geölte Maschine funktionieren, unabhängig davon, wer an der Spitze des Staates steht. Der Herrscher soll möglichst unsichtbar bleiben, seine Herrschaft wird entpersonalisiert und damit den normalen menschlichen völlig Sphären entrückt.
Konfuzius und seine Mitdenker vertraten noch das Ideal des tugendhaften, vorbildlichen Herrschers, der sich in alter Tradition vor dem Himmel als dem Höchsten verantworten musste. Das Volk und die Zustände, in denen es lebte, stellten für den Herrscher einen Spiegel dar, in dem er sehen konnte, ob er seine himmlische Aufgabe ordentlich erfüllt. Die Legalisten entthronten den Himmel und verzichteten auf jede Moral. Was zählte war allein der absolute Herrscher, der sich vor dem Himmel nicht mehr verantworten musste. Zur Seite stehen ihm Gesetze und Werkzeuge.
Die Legalisten propagierten ein System, das die Arbeit der Bauern genau überwachte. Ihnen wurde exakt vorgeschrieben, wie viel Getreide sie abzuliefern hatten. Wie viel davon ein Staat erzeugen konnte, entschied am Ende über die Stärke seiner Armee, so der weit verbreitete Glaube. Die Bevölkerung wird einer totalen Militarisierung unterworfen. Jeder kleine Fehler, jede kleine Nichtbeachtung eines Gesetzes zog drakonische Strafen nach sich, die ungeachtet äußerer Umstände automatisch verhängt wurden. Gesetze wurden generell nie zum Schutz des Individuums, sondern immer nur zu Zementierung der Macht des Herrschers eingeführt. Das ist ein grundlegender Unterschied zum antiken Griechenland und Rom sowie zu den Gesetzen des Hammurabi in Babylon (gestorben 1750 v.u.Z.), die u.a. die Schwachen vor den Starken schützen sollten.
*Die Sklaverei ist nicht in der Welt, sie ist in uns – „Welten der Sklaverei – Eine vergleichende Geschichte“ erschien bereits 2021 bei den Éditions du Seuil in Frankreich. Thema ist die Geschichte der Sklaverei vom Ende der Bronzezeit bis heute. Nun liegt endlich auch die deutsche Übersetzung vor
Mit Hilfe neuer Berechnungsmethoden und Steuern wurde ein Maximum aus den natürlichen Ressourcen und der Arbeitskraft der Bevölkerung herausgepresst. Es erfolgt eine völlige Neuordnung der Organisation der Bevölkerung, die in ein enges Raster und eine genaue Überwachung gezwängt wird. (Das antike Chinesisch verfügte über kein Wort für einen freien Menschen. Siehe auch: Die Sklaverei ist nicht in der Welt, sie ist in uns*) Kaufleute und Handwerker sind per se suspekt, weil sie aus eigener Kraft reich werden können. Reichtümer sollen allein dem Monarchen zur Verfügung stehen. Absoluten Vorrang hat die Agrarproduktion aus, wie Romain Graziani schreibt, komplexen und oft irrationalen Gründen. Der Hauptgrund liegt für ihn darin, dass erstens die Armee ernährt werden muss und dass zweitens, Felder vermessen, Arbeitszeit und Ernten gemessen und gewogen und damit genau quantifiziert werden können.
Shang Yang betonte immer wieder die absolute Notwendigkeit einer souveränen Autorität. Das Volk wollte er dagegen in Dummheit (ignorance) und Armut (précarité) halten. Ein weit blickender Herrscher sollte sein Volk in körperlicher Erschöpfung in ländlicher Einfachheit halten. Wer durch eigene Initiative und Intelligenz reich würde, sollte enteignet werden, denn diese Menschen würden nur die Autorität und das Prestige des Herrschers mindern so wie die Würde der Beamten. Die Verwaltung aber stützte sich nicht mehr auf die alten adeligen Familien. Diese verloren (zunächst) ihre Teilhabe an der Macht. Nur wer die vorgeschriebenen Examen erfolgreich bestanden hatte, sollte nach seinen Verdiensten Karriere machen können.
Die Theorien und Ideen der Legalisten wurden im Reich Qin konsequent in die Tat umgesetzt. Durch sie wurde das Königreich so stark, dass es seine Rivalen nach und nach besiegen und sich sein Herrscher 221 v.u.Z. als erster Kaiser Chinas etablieren konnte. Aber schon unter seinem Sohn wurde die Dynastie Qin 206 v.u.Z. gestürzt. Die unbarmherzigen Gesetze führten zu einem Aufstand und der Errichtung der Dynastie Han. Diese führte moralische Elemente des Konfuzianismus wieder ein, behielt aber die meisten Gesetze und die Struktur der Verwaltung bei. Man sagt noch heute in China, am Tag huldige man dem Konfuzius, aber in der Nacht regieren die Legalisten.
Am Ende des Kapitels schreibt der Autor: Die Ignoranz der Gesetze der Ökonomie, die spöttische Verachtung des Volkes, der systematische Rückgriff auf Gewalt und seine desaströsen Folgen könnten aus Shang Yang eine Art von Vorläufer maoistischer Politik machen, wäre da nicht die tiefsitzende Achtung des Ersten Kaisers von China vor der Idee der Objektivität von Gesetzen und der Unpersönlichkeit des Herrschers und Gleichgültigkeit gegenüber seinem Leiden. Beides gilt für Mao ausdrücklich nicht. Mao Zedong hatte in der Abschlussarbeit am Ende seiner Schulzeit einen sehr positiven Text über Shang Yang geschrieben. Weiter schreibt Romain Graziani, dass die Ansichten über Landwirtschaft, Handel, Krieg und Verteidigung, die sich zur Zeit der Streitenden Reiche herausgebildet hatten, wesentliche Elemente in der Geschichte der chinesischen politischen Kultur geblieben sind.
So hat Mao Zedong in seinem Großen Sprung nach vorn (1958 - 1961) den chinesischen Bauern völlig unrealistische Abgaben an Getreide vorgeschrieben. Im Rahmen des Fünf-Jahres-Plans verhungerten zwischen 20 – 40 Millionen Menschen, während in vollen Silos das Getreide verdarb. Es sollte ins Ausland verkauft werden, um Devisen für den Aufbau der Armee zu generieren. Schon in der Dynastie Qin dienten die Getreidevorräte zuallererst der Armee und nicht der Ernährung des Volkes. Xi Jinping formulierte 2013 dieses Ziel: Man muss eine gemeinsame (verzahnte) Planung des Aufbaus der nationalen Ökonomie und der Verteidigung durchführen, damit eine perfekte Einheit zwischen dem Wohlstand des Landes und der Armee realisiert werden kann. Man beachte: Xi Jinping spricht vom Wohlstand des Landes und nicht vom Wohlstand der Menschen.
Die Realität und ihre Zahlen
Die Legalisten überführten das Denken aus alten mystisch geprägten Bahnen in eine abstrakte Moderne. Ihr Fehler besteht darin, dass sie alles auf die Spitze trieben. Schon vor den Legalisten spielten Zahlen eine große Rolle in der chinesischen Mythologie und Kosmologie. In der Denkweise der Legalisten sind Zahlen aber nicht mehr allein magisch, sondern zuallererst rein quantitativ. Die Qualität verschwindet, sie ist allenfalls noch ein Schatten ihrer selbst. Was allein zählt, ist die Quantität. Alles, bis hin zum Menschen, kann in Zahlen ausgedrückt werden. Das erinnert an den europäischen Positivismus und den amerikanischen Fordismus/Taylorismus, der die industrielle Produktion revolutionierte, sowie an die sich etablierende totale Herrschaft von Zahlenreihen aus 0 und 1 in unserer digitalen Welt.
Im Reich der Qin müssen die Soldaten ihren Wert durch die (zählbaren) Köpfe getöteter Soldaten beweisen und werden kollektiv bestraft, wenn sie die vorgegebenen Quoten nicht erreichen. Wer Dinge und Ideen in Zahlen kleidet, verschafft sich einen Nimbus von Objektivität, der ab- und ausschließend wirkt. Das Gesagte kann und darf nicht mehr kritisiert werden. Die große Rolle, die die Zahlen in der chinesischen Gesellschaft bis heute spielen, konnte man bei Mao ebenso sehen wie noch heute bei jeder Kampagne, die die chinesische Regierung anstößt. Es gibt laut Romain Graziani keine einzige Zivilisation auf unserem Planeten, die den Zahlen jemals eine solch bedeutende Rolle zugewiesen hat. Dazu zwei Aussagen: Erstens: Das chinesische Denken hat einen Horror vor dem Undefinierbaren. Zweitens: Ohne Zahlen, keine Kontrolle, ohne zu messen, keine Handhabe über die Dinge.
Das neue Werkzeug der Macht
Die Einführung einer Bürokratie unter den Legalisten, die auf Ausbildung und Verdienst beruhte, musste zuerst den Widerstand des Adels brechen. Absolut neu für China war auch die Tatsache, dass die Gesetze veröffentlicht wurden (Hammurabi tat dies schon in Babylon). Der Adel empfand das als eine wesentliche Einschränkung seiner Macht, weil das Volk sich nun selbst eine Meinung über gefällte Urteile bilden konnte. Auch Konfuzius soll gegen die Veröffentlichung von Gesetzen gewesen sein. Er war auch für eine strikte Trennung von Adeligen und Nicht-Adeligen, ohne die ein Regieren unmöglich sei. Anhänger des Konfuzianismus waren sich mit den Legalisten einig, dass die Bevölkerung streng überwacht werden müsse.
Für Legalisten zeichnet sich ein Gesetz durch vier Charakteristika aus: 1. Uniformität. Das heißt, ein Gesetz sollte überall gültig sein und keine lokalen oder regionalen Abweichungen gestatten. 2. Lesbarkeit und Klarheit, so dass jeder das Gesetz verstehen kann. 3. Belohnungen und Strafen, die durch ein Gesetz vorgesehen sind, sollen immer unabhängig von Stand und Ansehen der Person ausgesprochen werden. 4. Ein Gesetz gilt für Adel und Volk gleichermaßen. Dazu Romain Graziani: Historisch gesehen ist die Gleichheit vor dem Gesetz in der Periode der Legalisten und das Prinzip der Meritokratie die einzige Form der Gleichheit, die jemals im politischen System Chinas erdacht und verwirklicht wurde.
Die Einführung des neuen Systems über das Königreich Qin hinaus in ganz China war nicht einfach und schon gar nicht überall umzusetzen. Die Vertreter der Bürokratie mussten sich oft genug nolens volens mit den örtlichen Verhältnissen arrangieren. Rebellion und allgemeiner Widerstand waren weit verbreitet. Ähnlich wie Ludwig XIV. in Frankreich zwang auch der Erste Kaiser Chinas wichtige adelige Familien, sich in der Hauptstadt niederzulassen, damit er sie besser kontrollieren konnte. Die harten Gesetze sollten der Theorie nach dazu führen, dass sich jeder aus Angst gesetzeskonform benimmt, so dass sie nicht angewandt werden mussten, aber diese Rechnung hatten die Legalisten ohne die menschliche Natur gemacht. Hinzu kam, dass die Repräsentanten der kaiserlichen Verwaltung oft nur mit Korruption über die Runden kamen, weil sie schlecht bezahlt wurden. Gerade weil alles genau gewogen und abgemessen wurde, ließen die strengen Gesetze und Kontrollen Betrügereien regelrecht explodieren.
Wie schon erwähnt, scheiterte die Dynastie Qin nach wenigen Jahren vor allem wegen ihrer drakonischen Gesetze. Unter den Anführern der Aufständischen setzte sich der einfache Beamte Liu Bang durch, er wurde der erste Kaiser der Han-Dynastie. Für ihn galt der Spruch Wer einen Angelhaken stiehlt, endet am Galgen, wer ein ganzes Königreich stiehlt, endet auf dem Thron.
Der Kult der Unpersönlichkeit
In der Epoche der Dynastie Zhou (1045 – 256 v.u.Z.; sie umfasst die Epoche der Frühlings- und Herbstannalen von 1045 – 771 und die Zeit der Streitenden Reiche von 771 – 221 v.u.Z.) galt der König noch als Primus inter Pares. In der chinesischen Kaiserzeit (von 221 v.u.Z - 1911) oszillierte die Monarchie ständig zwischen zwei Modellen: herrschen oder regieren. Wer herrscht zelebriert sein Leben weit entfernt von den täglichen Aufgaben, wer regiert widmet sich ihnen voll und ganz. Die Legalisten gingen davon aus, dass ein Herrscher niemals seinen Ministern vertrauen kann, und seinen Untertanen genauso wenig. Menschen sollten nicht zu besseren Untertanen erzogen werden, sondern ihnen sollte jede Möglichkeit genommen werden, dem Staat schaden zu können. Weder fordert ein Kaiser Tugenden ein noch fördert er sie. Beides wären nutzlose Bemühungen, die immer an der Natur des Menschen scheitern müssten. Folglich kümmert er sich nur um gesetzliche Normen und Verfahren. Es galt einen engen institutionellen Rahmen zu entwickeln, dessen Zwänge nicht nur den engsten Mitarbeitern sondern ebenso allen Untertanen keinen Spielraum für eine Missachtung der Gesetze bot. Nur dann konnten Ordnung und Harmonie herrschen.
*Ein Diktator ist auch nur ein Mensch… – ...und das ist wahrscheinlich die größte Beleidigung für Xi Jinping. Eric Meyer (Text) und Gianluca Costantini (Illustrator) erzählen das Leben von Xi Jinping in ihrer Graphic Novel „Xi Jinping L’Empereur du Silence“
Diese Auffassung der Legalisten stellte einen direkten Angriff auf die Stellung der Weisen im Konfuzianismus dar. Um einen Staat zu regieren sollte man von den Bedürfnissen der größten Anzahl ausgehen und nicht von dem, was den Interessen kleiner Minderheiten diente. Ein Kaiser sollte immer und überall in seinem Reich eine Machtposition innehaben, die ihm oder seinem ersten Minister erlaubte, jede mögliche Situation meistern zu können. Im Idealfall schwebte der Kaiser über allem und allen, auf seine individuelle Persönlichkeit sollte es nicht mehr ankommen. Je unpersönlicher sich ein Kaiser zeigte, desto ehrwürdiger und mächtiger würde er als lebendes Prinzip einer monarchistischen Staatsauffassung erscheinen. Chinas Staatspräsident Xi Jinping, der schon in früher Jugend unter härtesten Bedingungen lernen musste, sein Denken zu verbergen, erfüllt diese Forderung der Legalisten mit seinem in aller Welt bewunderten maskenhaften Gesichtsausdruck auf vollkommene Weise. (Siehe auch: Ein Diktator ist auch nur ein Mensch*)
Das Ideal der totalen Information und Kontrolle konnten die Legalisten nie vollständig verwirklichen. Schon den Widerspruch, dass ein Kaiser das tägliche Regieren delegieren und gleichzeitig seine Minister zu 100 Prozent kontrollieren sollte, konnte niemand auflösen. Aber die Legalisten waren unfähig, ein anderes Staatsmodell als die Monarchie zu denken. Die strengen Gesetze verbunden mit absoluter Macht konnten allzu leicht in Tyrannei ausarten, Widerstand war ja innerhalb des Systems weder vorgesehen noch möglich. Hier liegt für Romain Graziani die Ursünde der Legalisten. Behindert wurden auf lange Sicht auch Innovationen und technischer Fortschritt, denen ja immer auch etwas Umstürzlerisches innewohnt.
Kompass, Hebel und Armbrust: das Maß und der Tod
So gut wie alle Zivilisationen haben von technischen Erfindungen profitiert, vom Transport auf Flüssen, von Türangeln, vom Mechanismus einer Armbrust, von der Waage mit Gewichten, vom Rad. Aber nur die Chinesen haben diese Objekte zur Grundlage ihrer theoretischen Überlegungen gemacht. Der Abzug der Armbrust, die Radnabe und Hebelwerkzeuge werden zu Markenzeichen und Wegweisern (blasons) für Strategen und Politiker. Man siegt nicht durch Tapferkeit, nicht durch Kraft oder Macht (force), sondern durch List (machinations). Noch das heutige Vokabular der Macht im modernen Chinesisch ist tief geprägt von Analogien und Metaphern, die sich zur Zeit der Legalisten aufgrund von Werkzeugen entwickelt haben. In diesen Sprachbildern entwickelt sich eine mechanistische Vorstellungswelt, die Effektivität als Ratio zwischen Anstrengung und Wirkung auffasst. Produktivität und Machtmittel werden durch Hebelwerkzeuge versinnbildlicht. Letzteres findet sich auch im englischen Wort leverage. Mit dem Eingang von Waffen als Ankerpunkte politischer Reflexionen entdeckt, so Romain Graziani, das Gesetz sein martialisches Gesicht.
Belohnungen und Strafen: der Mangel an Moral der Legalisten
Dieses Kapitel geht noch einmal im einzelnen auf Belohnungen und Strafen ein, auf Zuckerbrot und Peitsche. Manches wiederholt sich, wird aber mit vielen Details angereichert. Brutale Beamte gelten zum Beispiel als durchaus vorbildliche Diener des Staates. Käuflichkeit, Keim der Unordnung, kann als mächtiger Hebel benutzt werden, um eine Ordnung herbeizuführen, die so absolut ist, wie diejenige, die die Elemente des Himmels beherrscht. Wer bestraft wird, wird dies oft für sein ganzes Leben, z. B. durch Tätowierungen im Gesicht. In einem Artikel der Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 24. Oktober dieses Jahres vergleicht ein chinesischer Unternehmer, der bankrott gegangen ist, sein Verbot als Schuldner einen Schnellzug zu benutzen mit dieser alten Praxis.
Hier möchte ich in eigener Übersetzung aus der französischen Vorlage ein Gedicht von Mao Zedong anführen, das Romain Graziani diesem Kapitel vorangestellt hat:
Ich rate Ihnen den ersten Kaiser nicht zu kritisieren,
Man müsste wieder über die lebendig begrabenen Gelehrten sprechen, über das große Autodafé.
Der Drache der Ahnen ist vielleicht tot, aber Qin lebt weiter,
Die konfuzianische Kultur, so hoch sie auch geschätzt wird, ist nichts weiter als klebriger Rest und Abfall.
Seit hundert Generationen bestimmt Qin das Gesetz.
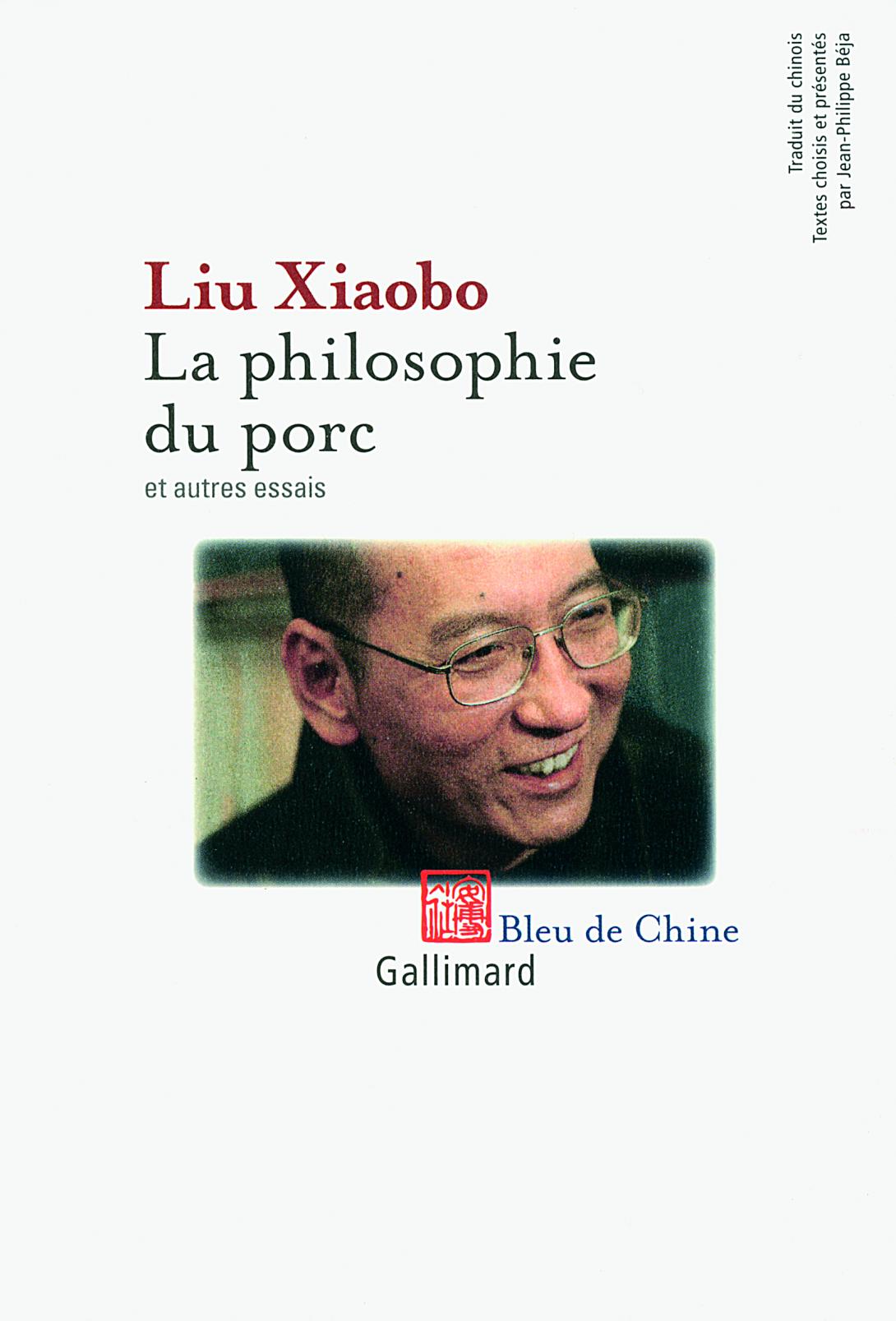 Gallimard
GallimardLiu Xiaobo | La philosophie du porc et autres essais | Gallimard | 528 Seiten | 26,40 EUR
Wer eine Gefahr für die höchste Autorität darstellt, wird getötet (wenige Ausnahmen bestätigen die Regel). Moderne Beispiele sind das Massaker an protestierenden Studenten 1989 und der elende Tod von Liu Xiaobo im Gefängnis wegen jahrelanger Verweigerung jedweder medizinischer Hilfe. Der Friedensnobelpreisträger des Jahres 2010 hatte es gewagt, die Machthaber öffentlich scharf zu kritisieren und ihre Speichellecker beim Namen zu nennen. (siehe auch: Liu Xiaobo La philosophie du porc, erschienen 2011 bei Gallimard)
Überwachung und Unterwerfung, von der Eisenzeit bis zur digitalen Ära
Romain Graziani sieht eine chinesische Tradition der Überwachung des Volkes, die seit 3000 Jahren ohne Unterbrechung funktioniert. Seit dem vierten Jahrhundert v.u.Z. gebe es eine Obsession, die Bevölkerung auszuspionieren. Dies sei ein grundlegender Zug der chinesischen Verwaltung durch die Jahrhunderte. Ein solches Verhalten habe es in keiner vergleichbaren antiken Gesellschaft gegeben. Heute aktivierten sich Millionen menschliche Augen und Ohren sowie automatische Sensoren im Dienste des Staatschefs. Der Gedanke dränge sich auf, dass die jüngste Evolution der Informationstechnologien die allerletzte Umsetzungsphase der theoretischen Möglichkeiten einleitet, die man in der Doktrin der totalen Überwachung der legalistischen Denker findet. Es gebe keine andere Regierung die die neuen technischen Möglichkeiten der Überwachung so konsequent ausnutze wie die chinesische. Für die Chinesen selbst sei diese Überwachung nichts grundsätzlich Neues, weil sie keinen Bruch mit der Tradition darstelle.
Im Reiche Qin (wie im heutigen China) verhöhnten Gerüchte, Groll zwischen Nachbarn, verleumderische Denunziationen und die Aussicht auf Gewinn die ursprüngliche Absicht dieser Kontrolle eines jeden durch alle im Namen der Gerechtigkeit und des Gemeinwohls. Ein Beispiel: Die KPCh fordert derzeit eine verstärkte Überwachung von Führungskräften in Unternehmen und öffentlichen Verwaltungen, die sogar so weit geht, dass deren Verhalten außerhalb des Arbeitsplatzes bewertet wird, indem Untersuchungen zu ihrer Moral (Ehetreue, Nachtleben) oder ihrer Familienethik durchgeführt werden. Diese Kontrollen hätten aber einen Preis, denn sie behinderten die wirtschaftliche Entwicklung Chinas.
Der Eine, trotz alledem
Der Eine (oder sagt man im Deutschen besser das Eine?) verbindet sich mit Harmonie und Eintracht. Die Zahl Eins gilt in China von jeher als das Emblem der Totalität. Aus der Eins, der Großen Einheit, folgt alles. Ordnung, Macht, Wohlstand, Stabilität und Frieden sind untrennbar mit der Eins verbunden. Bis hinein ins 20. Jahrhundert konnte man sich in China keine andere Staatsform als die Monarchie vorstellen. Das Gegenstück zum Einen, zum Monarchen, ist das Volk, das auf einer Waage dem Gewicht des Einen gleich ist. Es ist ein Sinnbild der Harmonie und bedeutet in seiner Konsequenz, dass das Volk auf ein kindliches Ganzes reduziert wird.
Das Eine ist aber auch China selbst. Der eine, alles überstrahlende Kulturkreis, die Mitte von allem. Ähnlich wie die alten Griechen betrachteten auch die alten Chinesen alle anderen als Barbaren. Kurios: China kannte keine festgelegten Grenzen. Es gab das Kernland und die Vasallen, alles Land dahinter galt als unwichtig. Wörter wie Staat, Land und Nation wurden erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bewusst in die chinesische Sprache eingeführt. Die erste offizielle Grenze Chinas wurde 1689 im Vertrag von Nertschinsk zwischen Russland und China festgelegt.
China verstand sich traditionell als Das Ganze unter dem Himmel und von daher allen anderen Zivilisationen als überlegen. Die militärische Übermacht Europas und Amerikas im 19. Jahrhundert war auch ein großer psychologischer Schock. Man könne im 21. Jahrhundert, so Romain Graziani, den Versuch beobachten, eine Synthese des modernen Staates mit der himmlischen Ordnung zu etablieren. Die Philosophie dazu liefern die Schriften Xi Jinpings. Der Kult der Einheit erscheint mehr und mehr als eine Bestätigung der höheren Bestimmung, die das Land seinem ultimativen Punkt der Vollendung zuführt, indem es der Dreh- und Angelpunkt einer neuen Weltordnung wird und damit der Garant des Endes aller Uneinigkeiten und Spaltungen.
Dass China große Ambitionen verfolgt, dazu hat es jedes Recht. Niemand soll und kann ihm dieses Recht streitig machen. Aber niemand sollte auch vergessen, was Roman Graziani zu Beginn seines Buch schreibt: dass man bei allem, was folgt, immer das Buch Die Kunst des Krieges von Sun Tzu (Sunzi) mitdenken müsse.
Hat Ihnen dieser Text gefallen? Dann unterstützen Sie doch bitte unsere Arbeit einmalig oder monatlich über eins unserer Abonnements. Wir würden uns freuen!
Wollen Sie keinen Text mehr auf Literatur.Review verpassen? Dann melden Sie sich kostenlos für unseren Newsletter an!



