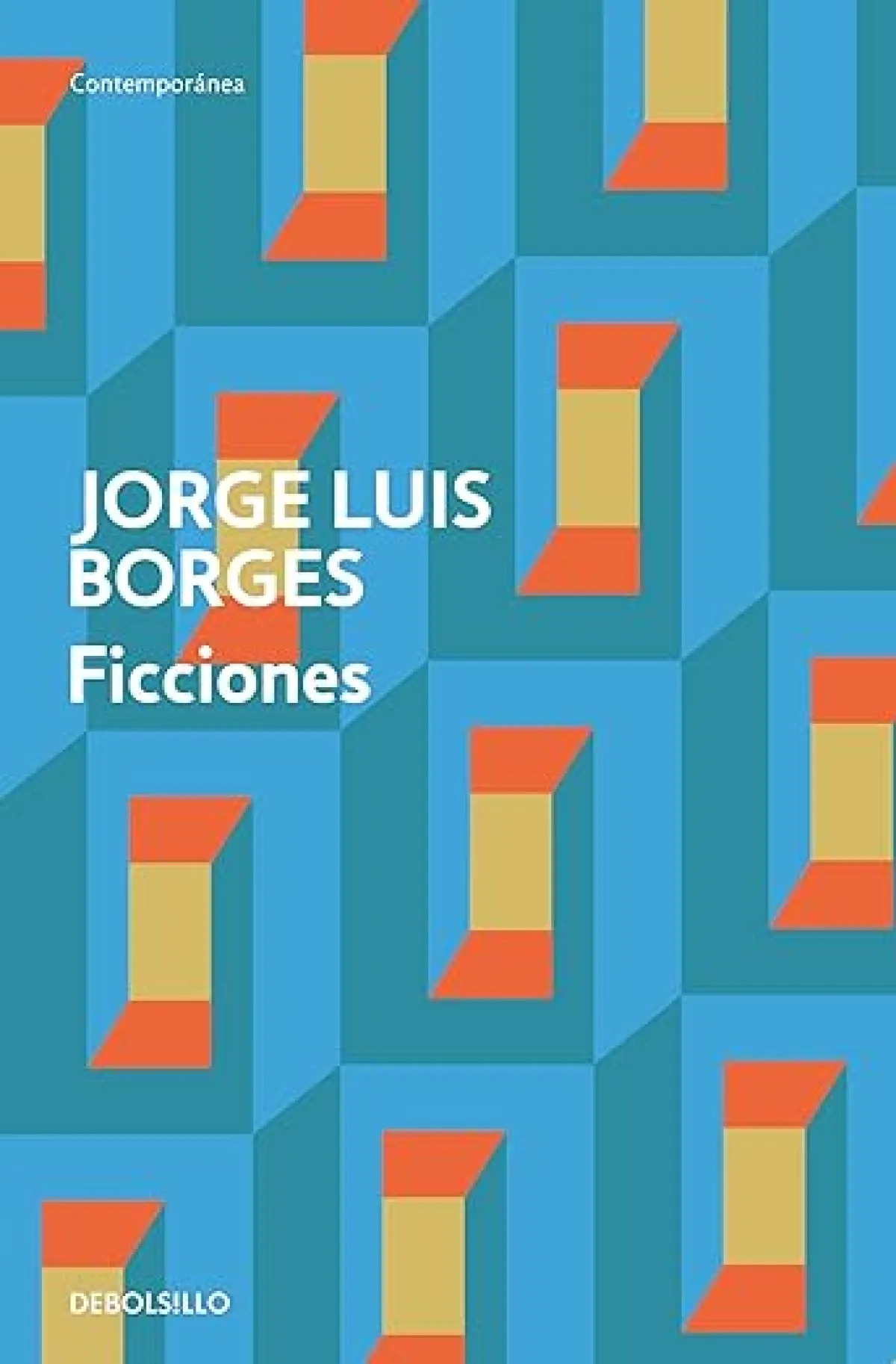Wider die „koloniale Amnesie“

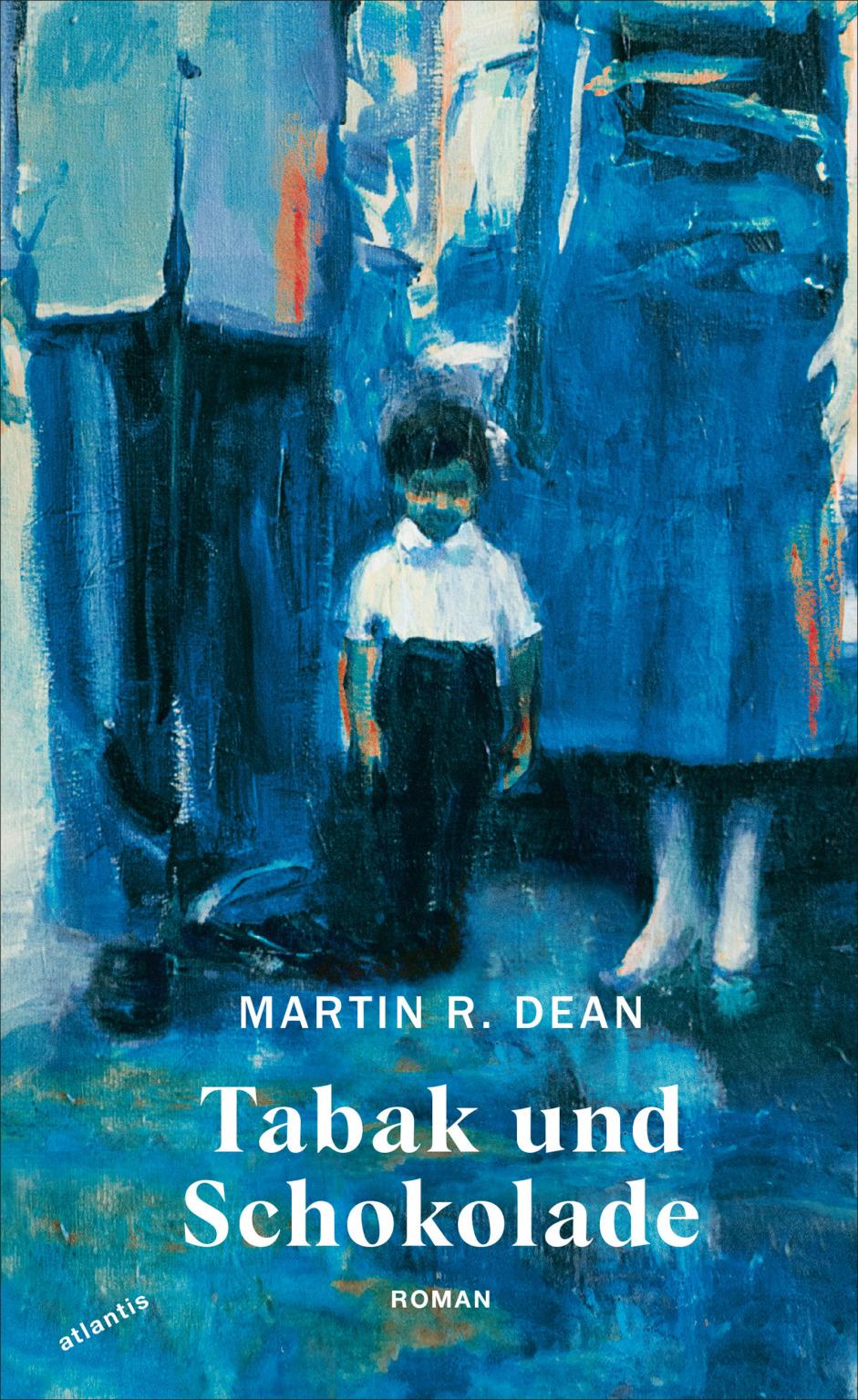 Atlantis
AtlantisMartin R. Dean | Tabak und Schokolade | Atlantis | 224 Seiten | 22 EUR
In Jorge Luis Borges’ Kurzgeschichte Funes, el memorioso (Ficciones) erinnert sich ein Ich-Erzähler in den 1940er Jahren an seine Begegnungen mit Ireneo Funes, der 1889 im Alter von 21 Jahren starb. Der seit einem Unfall gelähmte Funes verfügt über ein unfehlbares Gedächtnis: Er erinnert jedes Detail, kennt „las formas de las nubes australes del amanecer del treinta de abril de mil ochocientos ochenta y dos y [puede] compararlas en el recuerdo con las vetas de un libro en pasta española que sólo había mirado una vez“. (1)
Für den Schweizer Autor Martin R. Dean ist diese Kurzgeschichte von anhaltender Bedeutung. Bereits in seinem Debütroman Die verborgenen Gärten von 1982 zieht Dean eine Verbindungslinie dazu, indem er den zitierten Satz über die Wolken vom 30. April 1882 aufnimmt. (2) In Monsieur Fume (!) oder Das Glück der Vergesslichkeit lässt er 1998 die Figur als obsessiven Wolkenbeschreiber wiederauferstehen. In Ein Stück Himmel von 2022 variiert er das Motiv erneut, wenn der Freund der Hauptfigur seit einem Unfall gelähmt ist und von einer Überfülle an Erinnerungen heimgesucht wird. Und noch für Deans jüngstes Schaffen bleibt Borges’ Kurzgeschichte ein Bezugspunkt – das zeigt sich, wenn man Funes, el memorioso aus einem postkolonialen Blickwinkel betrachtet.
Zwar ist Borges’ Funes-Geschichte zunächst als Allegorie auf Geschichtsschreibung überhaupt angelegt: Aus zeitlicher Distanz spricht ein Erzähler über eine Figur mit absolutem Gedächtnis und legt die Spannung zwischen der vollständigen Verfügbarkeit von Erinnerung und ihrer immer verspäteten, sprachlich geformten Darstellung offen. So wird das Grundproblem historiographischen Erzählens exponiert: dass kein Erinnern ohne Auswahl und kein Bericht ohne Formung möglich ist. Bislang kaum beachtet wurde jedoch, dass diese Allegorie in ein koloniales Setting eingebettet ist. Funes wird ausdrücklich als „indianisch“ (3) bezeichnet, in der peripheren Provinz verortet und mit exotisierenden Zuschreibungen versehen, die ihm historische und soziale Konkretion entziehen: als „Zarathustra“ (4), „älter als Ägypten“ (5), „monumental wie Erz“. (6) Zugleich wird er sprachlich entmächtigt: „Ich werde nicht versuchen“, erklärt der Erzähler, „seine Worte wiederzugeben“. (7) „Prefiero resumir con veracidad las muchas cosas que me dijo Ireneo.“ (8) Borges’ Text führt demnach auch vor, wie koloniale Geschichtsschreibung funktioniert. Die Deutungshoheit liegt beim weißen, „[i]ntelektuelle[n]“ „Städter“ (9), der Erinnerung für den „Indianderjungen“ rekonstruiert und formt. (10) Der Kolonisierte wird zur Quelle, aber nicht zum sprechenden Subjekt. (11)
 Hanser
Hanser
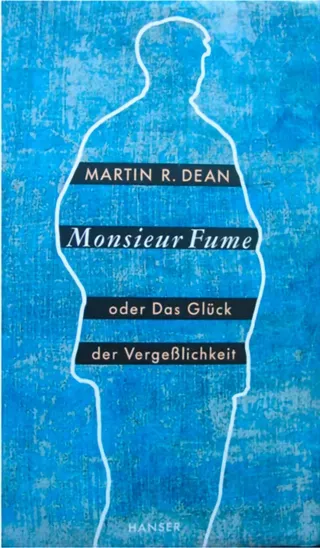 Hanser
Hanser
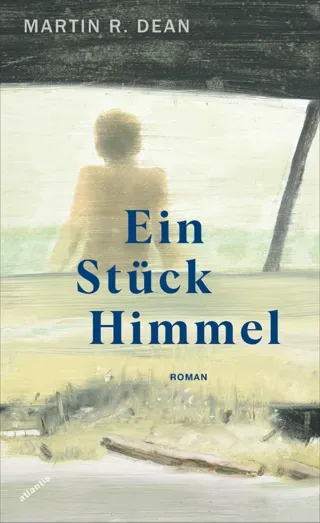 Atlantis
Atlantis
 Atlantis
Atlantis
Damit sind Problemfelder angesprochen, die auch Dean in seiner aktuellen Essaysammlung In den Echokammern des Fremden (2025) beschäftigen: Mechanismen der Stereotypisierung, selektives Erinnern, Kolonialismus. Dean beschreibt beispielsweise, wie er als Sohn einer Schweizer Mutter und eines indischstämmigen Vaters aus Trinidad und Tobago seit Kindheitstagen in seinem aargauischen Zuhause rassistischen Zuschreibungen ausgesetzt war und wie sich die Geschichte des nichtschweizerischen Familienzweigs, über den geschwiegen wurde, nur schwer erschließen ließ. Diese Schwierigkeit kann – wie bei Borges – allegorisch gelesen werden: Sobald Dean seiner Herkunft nachgeht, entdeckt er, „dass [s]eine kleine Geschichte mit der großen Geschichte des Kolonialismus“ (12) verbunden ist. Das familiäre Schweigen erscheint damit als Symptom einer umfassenden ‚kolonialen Amnesie‘ – eines „aktive[n] Vergessen[s] der Zusammenhänge zwischen der Schweizer- und der Kolonialgeschichte“. (13) Mit diesem Begriff der ‚kolonialen Amnesie‘ knüpft Dean explizit an postkoloniale Gedächtniskritik im Gefolge Stuart Halls an und stimmt zugleich in ein Forschungsfeld ein (14), das in den letzten Jahren erheblich an Dynamik gewonnen hat: Die jüngere Geschichtswissenschaft hat die „Swiss entanglements with colonialism“ (15) derart stark ins Zentrum gerückt, dass Georg Kreis 2023 einen rund 200-seitigen Forschungsbericht dazu vorlegen konnte. (16)
Noch bevor die geschichtswissenschaftliche Aufarbeitung an Fahrt aufnahm, setzte Deans literarische Erinnerungsarbeit ein – bereits in Der Guyanaknoten (1994) und Meine Väter (2003) verfolgte er Schweizer Kolonialverstrickungen. Daran knüpft auch sein jüngster Roman Tabak und Schokolade (2024) an, der als autofiktionales Erinnerungsprojekt angelegt ist und Funes, el memorioso insofern verpflichtet bleibt, als Borges’ Kurzgeschichte – so die Herausgeberfiktion in Ficciones – Teil eines Erinnerungsbandes sein soll. Während der Erzähler von Funes, el memorioso allein auf sein fehleranfälliges Gedächtnis angewiesen bleibt, erschließt der Protagonist von Tabak und Schokolade Erinnerung jedoch über verschiedene weitere Speicher. Drei davon sollen im Folgenden exemplarisch verfolgt werden: Fotografien als mediale Gedächtnistrigger, Nahrungs- und Genussmitteln als Indexe neokolonialer Verflechtungen und menschliche Körper als Archive transgenerationaler Traumata. Sie alle setzen im Roman Erinnerungsprozesse in Gang, die koloniale Geschichte dem Vergessen entziehen.
Fotografien
Der Roman Tabak und Schokolade beginnt mit dem Tod der Mutter des Protagonisten. Die Biographie dieses Protagonisten stimmt weitgehend mit derjenigen Deans überein. 1955 geboren, verbrachte er die ersten fünf Lebensjahre auf Trinidad, das damals noch „fest in britischer Hand“ (17) war. Nachdem sich seine Mutter vom Vater getrennt hatte, kehrte sie mit ihrem Sohn in die Schweiz zurück, wo sie erneut heiratete – wiederum einen karibischen Mann indischer Herkunft.
Bereits bei der Trauerfeier wird jenes familiäre Schweigen deutlich, gegen das Dean auch in seinen Essays anschreibt: In dem öffentlich verlesenen Lebenslauf der Mutter fehlen die „fünf Jahre in Trinidad“ – „Totgeschwiegen […], meine Anfänge […], wie nie geschehen, weggeklemmt, wie man eine unanständige Szene in einem Film herausschneidet“ (Seite 63). Was im biographischen Schnelldurchlauf der mütterlichen Geschichte ausgelassen wird, bleibt allerdings im Stillstand der Fotografie erhalten. Im Nachlass der Mutter stößt der Erzähler auf ein Album, ein privates Gegen-Archiv, das bewahrt und als „certificat de présence“ Zeugnis davon ablegt (18), was aus dem sozialen und familiären Gedächtnis getilgt werden sollte: „Es sind Bilder aus der versunkenen Welt meiner Kindheit. Schwarz-weiße Abzüge von meiner Mutter und mir, […] von tropischen Stränden, Palmen, von lachenden Schwarzen Menschen.“ (Seite 14)
Diese im Roman reproduzierten Fotografien setzen eine Spurensuche in Gang, die narrativ als Schatzsuche inszeniert ist – ein ironisches Spiel mit kolonialen Abenteuererzählungen, deren Muster Dean bewusst aufruft und unterläuft. Die Bilder führen jedoch nicht nur auf den „versunkene[n] Kontinent“ (ebd.) seiner Kindheit zurück; sie öffnen zugleich den Blick auf verdrängte kolonialgeschichtliche Zusammenhänge.

Ein Foto beispielsweise zeigt den Erzähler als Kind zwischen Arbeiterinnen und -arbeitern einer Kakaoplantage (Seite 17), auf der seine Mutter als Sekretärin tätig war. Diese prima vista familiär-idyllisch anmutende Szene verweist auf die plantagenkapitalistische Ökonomie Trinidads, die in der weiteren Erzählung an ihre kolonialen Entstehungs- und Ausbeutungsstrukturen zurückgebunden wird und Reflexionen über die Geschichte von Sklaverei und Zwangsarbeit in Gang setzt, die den europäischen Wohlstand bis in die Gegenwart mitermöglichen.
Eine andere Aufnahme zeigt Irene, die schwarze Angestellte, die den Protagonisten als Kleinkind hütet (Seite 20), und verweist zunächst auf die sozialen und rassifizierten Hierarchien auf Trinidad. In der Erinnerung des Erzählers kehren solche Hierarchisierungen später in der Schweiz wieder, wenn er sein Kindheitsdorf als „weiß“ (Seite 38; Herv. i. O.) beschreibt und rückblickend versteht, weshalb seine eigene, von der Mutter beharrlich behauptete Zugehörigkeit – „Du bist ein Schweizer Bub, hörst du!“ (Seite 25) – gesellschaftlich prekär blieb. Die Fotografie schafft damit quasi einen transregionalen Resonanzraum. Sie ruft in Erinnerung, dass die Grenzziehungen, die in Trinidad strukturell waren, sich in der Schweiz alltäglich fortsetzten.

Poetologisch lässt sich dieses Verfahren, Fotografien als Auslöser einer narrativen Rekonstruktion verdrängter Geschichte zu nutzen, einerseits mit Saidiya Hartmans Praxis der „critical fabulation“ (19) in Beziehung setzen. In Wayward Lives, Beautiful Experiments (2019) nimmt Hartmann unter anderem Fotografien schwarzer Frauen um 1900 zum Ausgangspunkt, um deren ausgelöschte Stimmen in der Fiktion zurückzugewinnen. Andererseits knüpft Dean an W. G. Sebald an, in dessen Werk reproduzierte Fotografien zwischen autobiografischer Erfahrung und einer „überindividuellen“ „Epochensignatur“ (20) oszillieren. Dass Tabak und Schokolade ein Zitat aus Austerlitz vorangestellt ist (vgl. 5), verweist entsprechend darauf, dass auch hier eine persönliche Geschichte der Selbstsuche mit einer größeren, historisch belasteten Gewaltgeschichte verschränkt wird.
Nahrungs- und Genussmittel
Noch bevor im Roman die Fotografien in den Blick rücken, rufen bereits Titel und Cover zwei Erinnerungsspuren auf: Tabak und Schokolade. Über ihren Geschmack und Geruch erinnert sich der Erzähler an den „Schoppen[]“ (Seite 18; Herv. i. O.) seiner Kindheit bzw. an den Geruch des Großelternhauses (vgl. Seite 147) – ein Effekt, der der besonderen Bindung von olfaktorischen und gustatorischen Reizen an das episodische Gedächtnis entspricht. (21) Gleichzeitig stehen Tabak und Schokolade für Waren, deren globale Zirkulation in koloniale Wirtschafts- und Handelsverhältnisse eingebettet ist. Im Roman verknüpfen sie unterschiedliche Stränge der Familiengeschichte: Karibischer Tabak führt in den Aargau, wo die Großeltern in der Zigarrenproduktion bei Weber & Söhne bzw. Villiger beschäftigt waren; Schweizer Schokolade nach Trinidad, zur Kakaoplantage, auf der die Mutter arbeitete.
Tabak und Schokolade erscheinen damit nicht als entpolitisierte Konsumgüter, sondern als historisch situierte Produkte, die paradigmatisch koloniale Verflechtungen veranschaulichen: „Kolonialismus geht durch Mund und Magen“ (Seite 173). Entsprechend treten im Roman weitere Lebensmittel auf – Ananas, Bananen, Datteln, Orangen, Zitronen (vgl. Seite 183f.), Tee (vgl. Seite 121), oder Zucker (vgl. Seite 118) –, deren Handelswege sich über Kontinente und Jahrhunderte spannen. So entsteht ein kartografisches Bewusstsein: Jede dieser Waren fungiert als Indiz globaler Zirkulationen, in denen sich familiäre Erinnerung und koloniale Geschichte verschränken – ganz ähnlich wie in den Fotografien.
Besonders anschaulich tritt dieses Ineinandergreifen am Beispiel der Kartoffel hervor (vgl. Seite 145). Der Roman zeichnet ihre Migrationsgeschichte von den Hochanden über die spanischen Kolonien bis nach Europa nach – eine Geschichte, in der die Knolle in Zeiten der Krise sowohl Hunger linderte als auch Wanderbewegungen auslöste. In der Familiengeschichte des Erzählers führt die Kartoffelkrankheit im Emmental um 1850 zur Auswanderung des Schweizer Urgroßvaters nach Rügen. Dessen Tochter kehrt später in die Schweiz zurück, als sich die Lebensbedingungen auf Rügen verschlechtern.
Kurz gesagt: Der Roman zeigt, wie sich koloniale Verstrickungen an alltäglichen Waren ablesen lassen. Damit steht Dean in einer Reihe von Texten der letzten Jahrzehnte, die Kolonialwaren als Gedächtnismedien ins Zentrum rücken – häufig bereits im Titel –, ein Phänomen, das meines Wissens noch nicht systematisch untersucht worden ist. Zu nennen wären etwa Alessandro Bariccos Seta (1991), Dany Laferrières L’odeur du café (1991), Chitra Banerjee Divakarunis The Mistress of Spices (1996), Andrea Levys Fruit of the Lemon (1999), Dorothee Elmigers Aus der Zuckerfabrik (2020) oder Amitav Ghoshs The Nutmeg’s Curse (2021).
Körper (22)
Wenn koloniale Geschichte sich in Nahrungs- und Genussmitteln ablagert, dann wird sie im Essen buchstäblich einverleibt. Der Roman zeigt jedoch, dass dieselbe Geschichte auch als Hunger weitergegeben wird. In einer Schlüsselszene spricht der Protagonist mit seinen trinidadischen Verwandten über die Überfahrt seines Ururgroßvaters von Indien nach Trinidad im Jahr 1876. Nachdem die prekären Zustände auf den ehemaligen Sklavenschiffen – inzwischen Transportmittel für Kontraktarbeiter – zur Sprache gekommen sind, isst die Familie „mit dem Appetit von Überlebenden“: „Und als wir längst satt waren, aßen wir weiter, Kokosnusseis, Mangoeis, Schokoladeneis, damit wir sicher sein konnten, dass wir Kaala Pani [die Überquerung des Meeres] überstanden hatten, ein für alle Mal.“ (Seite 121; Herv. i. O.)
Das Essen über den Sättigungspunkt hinaus wirkt wie eine körperliche Selbstversicherung; als würde ein ererbtes Mangelgedächtnis beruhigt werden. An anderer Stelle spekuliert der Erzähler, das „Drama“ der „Hungerzeiten“ seiner Großmutter – „die im Krieg gekochte Schuhsohlen aß“ – habe sich in ihm niedergeschlagen (Seite 44). Hunger erscheint hier nicht mehr nur als physiologischer Zustand, sondern als transgenerationell übertragene Erfahrung, die sich als Empfindung, Haltung und Körperwissen fortsetzt. Das gilt auch für die Erfahrung der Entwurzelung: Die Verunsicherung des Vorfahren während der Überfahrt habe, so der Erzähler, in seinem „Körper“ (Seite 114) einen lebenslangen Drang zur Ortsveränderung hinterlassen.
Damit greift Tabak und Schokolade eine in der Trauma- und Epigenetikforschung diskutierte These auf: dass Erfahrungen einer Generation sich körperlich und psychisch in den Nachkommen fortsetzen können – dass, wie der Psychologe Brian Koehler formuliert, „the ‚nurture‘ of one generation“ zur „‚nature‘ of the subsequent generations“ werden kann. (23) Wenn der Erzähler seine indische Herkunft als „tief in den Knochen“ (Seite 87) steckend beschreibt, erfährt diese Idee eine buchstäbliche Verkörperung.
Auch im Phänotyp können sich archivische Spuren zeigen – etwa in den äußeren Ähnlichkeiten zwischen dem Erzähler und seinen Verwandten. Als der Erzähler seine Tante April das erste Mal sieht, ist er überrascht, „mein Gesicht in den Zügen der achtundachtzigjährigen Frau gespiegelt zu sehen“ (Seite 92). Zudem wird Haut zum Träger historischer Gewalt: Ihre „Farbe“ (Seite 43) wird sozial gelesen und ruft die Geschichte kolonial-rassistischer Abwertung auf. Der Roman verdeutlicht das beispielsweise in einer Szene, in der der Protagonist als Kind von einem Mitschüler mit dem N-Wort beschimpft wird, unmittelbar nachdem er in der Sonntagsschule eine Münze in eine „Nickn*“-Figur geworfen hat – ein Moment, der in ihm „[e]ine Hitze“ aufsteigen lässt, „die ihn zu verbrennen droht“ (Seite 24). In dieser Erfahrung verliert der Erzähler seine unmarkierte Zugehörigkeit, so wie Frantz Fanon es in Peau noire, masques blancs beschrieben hat: Unter dem kolonialen Blick zerfällt das „schéma corporel“ und weicht einem „schéma épidermique racial“ – der Körper wird auf seine Haut reduziert, auf ein Zeichen rassifizierter Differenz. (24)
Das Motiv der Verbrennung, auf das die Kindheitsszene zurückgreift, deutet in zwei Richtungen. Einerseits führt es zum Romananfang zurück, wo beschrieben wird, wie der betrunkene Vater auf Trinidad – unmittelbar bevor die Mutter vor ihm flieht – versucht, seine Zigarette auf der Haut des Kleinkinds auszudrücken, was ihm nicht gelingt (vgl. Seite 7). So entsteht keine Narbe, keine dauerhafte Spur; die Erinnerung bleibt körperlich ungesichert. Andererseits verweist das Verbrennungsmotiv auf die Lebensgeschichte des Schriftstellers Edgar Mittelholzer – eines Guyaners mit schweizerischen Wurzeln –, der sich nach Jahren rassisch bedingter Selbstabwertung – mit Fanon ließe sich sagen: nach vollendeter „épidermisation“ (25) – selbst mit Benzin übergießt und anzündet.
Die Episode mit der Zigarette kennt der Erzähler aus der Erinnerung der Mutter; sie ist eines der wenigen Fragmente, die sie ihm über seinen Vater erzählt. Auf die Spur Mittelholzers wiederum bringt ihn eine Buchhändlerin, die ihn mit dessen Literatur und Biographie – Mittelholzer hatte Vorfahren aus dem Appenzell – vertraut macht (vgl. Seite 130–132). Dessen Geschichte – und die Art, wie sie überliefert ist – öffnet den Blick darauf, dass Erinnerung im Roman als ein Netz von Übertragungen erscheint. Sie zirkuliert zwischen mündlicher Überlieferung, literarisch-künstlerischer Gestaltung, historiographischem Wissen und materiellen Trägern. Auf diese Weise bilden Geschichtsschreibung, oral history und Literatur gemeinsam mit jenen materiellen und affektiven Spuren, die der Roman aufruft – Körper, Fotografien, Kolonialwaren und – wie sich mit etwas mehr Platz zeigen ließe – auch Filme, Musik, Namen, Möbel oder Schamgefühle – ein vielstimmiges Archiv, das erst im Akt des Erzählens zu einem dichten Geflecht verknüpft wird. Indem Deans Roman diesen Prozess ausstellt und thematisiert, weist er auch in diesem Sinn erneut auf Borges’ Funes, el memorioso zurück, wo das Erinnern selbst zum Motiv und eigentlichen Anlass des Erzählens wird.
+++
Hat Ihnen dieser Text gefallen? Dann unterstützen Sie doch bitte unsere Arbeit einmalig oder monatlich über eins unserer Abonnements. Wir würden uns freuen!
Wollen Sie keinen Text mehr auf Literatur.Review verpassen? Dann melden Sie sich kostenlos für unseren Newsletter an!
(1) Jorge Luis Borges, „Funes, el memorioso“, in: ders., Ficciones, Madrid, Alianza, 1974, S. 123-136, hier S. 131: „Er kannte genau die Formen der südlichen Wolken des Sonnenaufgangs vom 30. April 1882 und konnte sie in der Erinnerung mit der Maserung auf einem Pergamentband vergleichen, den er nur ein einziges Mal angeschaut hatte“. Jorge Luis Borges, „Das unerbittliche Gedächtnis“, in: ders., Fiktionen. Erzählungen 1939-1944, übers. v. Karl August Horst, Wolfgang Luchting und Gisbert Haefs, Frankfurt a. M., Fischer Taschenbuch Verlag, 1992, S. 95-104, hier S. 100.
(2) Vgl. Martin R. Dean, Die verborgenen Gärten, München und Wien, Hanser, 1982, S. 85.
(3) Borges, Das unerbittliche Gedächtnis, S. 95: „aindiada“. Ders., Funes, el memorioso, S. 123.
(4) Borges, Das unerbittliche Gedächtnis, S. 95: „Zarathustra“. Ders., Funes, el memorioso, S. 124.
(5) Borges, Das unerbittliche Gedächtnis, S. 103: „más antiguo que Egipto“. Ders., Funes, el memorioso, S. 135.
(6) Borges, Das unerbittliche Gedächtnis, S. 103: „monumental como el bronce“. Ders., Funes, el memorioso, S. 135. Vgl. Madilyn Abbe, „‚Hopelessly Crippled‘. The Construction of Disability in Borge’s Funes, His Memory“, Criterion. A Journal of Literary Criticism, Bd. 16, Nr. 1, 2023, S. 13-27, hier S. 21-23.
(7) Borges, Das unerbittliche Gedächtnis, S. 99: „No trataré de reproducir sus palabras“. Ders., Funes, el memorioso, S. 129.
(8) Borges, Funes, el memorioso, S. 129: „Ich ziehe es vor, wahrheitsgetreu die vielen Dinge, die Ireneo mir sagte, zusammenzufassen.“ Ders., Das unerbittliche Gedächtnis, S. 99.
(9) Borges, Das unerbittliche Gedächtnis, S. 179: „Literato, […] porteño“. Ders., Funes, el memorioso, S. 123.
(10) Dean, Die verborgenen Gärten, S. 85.
(11) Vgl. Walter D. Mignolo, Local Histories / Global Designs. Coloniality, Subaltern Knowledges, and Border Thinking, Princeton, Princeton University Press, 2000, S. 91-214.
(12) Martin R. Dean, In den Echokammern des Fremden, Zürich, Atlantis, 2025, S. 75
(13) Ebd., S. 86.
(14) Vgl. Stuart Hall, „Die Frage des Multikulturalismus“, in: ders., Ideologie, Identität, Repräsentation, hg. v. Juha Koivisto und Andreas Merkens, Hamburg, Argument, 2004, S. 188-227; Stuart Hall, „The Multicultural Question [2000]“, in: ders., Essential Essays. Vol. 2: Identity and Diaspora, hg. v. David Morley, Durham, Duke University Press, 2019, S. 95-133.
(15) Patricia Purtschert und Harald Fischer-Tiné, „Introduction. The End of Innocence. Debating Colonialism in Switzerland“, in: dies. (Hg.), Colonial Switzerland. Rethinking Colonialism from the Margins, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2015, S. 1-26, hier S. 4.
(16) Georg Kreis, Blicke auf die koloniale Schweiz. Ein Forschungsbericht, Zürich, Chronos, 2023. Vom 13. September 2024 bis am 19. Januar 2025 war im Schweizer Landesmuseum außerdem die Ausstellung kolonial – Globale Verflechtungen der Schweiz zu sehen. Vgl. Schweizerisches Nationalmuseum (Hg.), kolonial. Globale Verflechtungen der Schweiz, Zürich, 2024 (zuletzt aufgerufen: 25.11.2025).
(17) Martin R. Dean, Tabak und Schokolade, Zürich, Atlantis, 2024, S. 9. Nachfolgend im Fliesstext in Klammern nachgewiesen.
(18) Vgl. Roland Barthes, La chambre claire. Note sur la photographie, Paris, Gallimard, 1980, S. 135. Der Verweis auf Barthes liegt auch deshalb nahe, weil Barthes seine Überlegungen im zweiten Teil der Note – wie Dean seinen Roman – mit dem Tod der Mutter beginnen lässt; freundlicher Hinweis von Cornelia Pierstorff, Zürich.
(19) Saidya Hartman, „Venus in Two Acts“, Small Axe Bd. 12, Nr. 2, 2008, S. 1-14, hier S. 11.
(20) Silke Horstkotte, „Photographie / Photographieren“, in: Claudia Öhlschläger und Michael Niehaus (Hg.), W. G. Sebald-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung, Stuttgart, Metzler, 2017, S. 166-174, hier S. 167.
(21) Vgl. Rachel Sarah Herz, „The Role of Odor-Evoked Memory in Psychological and Physiological Health“, Brain Sciences Bd. 6, Nr. 3, 2016 (zuletzt aufgerufen: 25.11.2025).
(22) Für wichtige Hinweise zu diesem Kapitel danke ich Alexander Bratschi, Bern.
(23) Zit. n. Jil Salberg und Sue Grand, Transgenerational Trauma. A Contemporary Introduction, Abingdon, Routledge, 2024, S. 34.
(24) Frantz Fanon, Peau noire, masques blancs, Paris, Éditions du seuil, 1952, S. 90.
(25) Ebd., S. 8.