Tote Zeit, totes Land

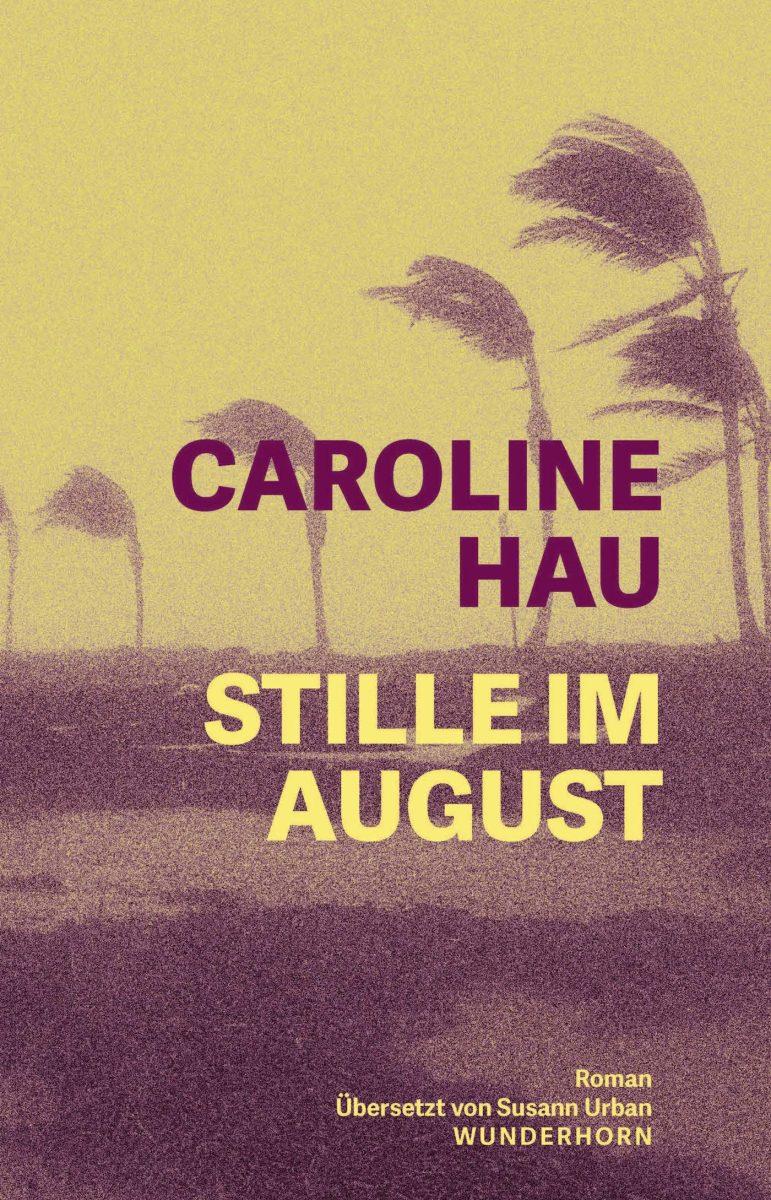 Wunderhorn
WunderhornCaroline Hau | Stille im August | Das Wunderhorn | 350 Seiten | 28 EUR
Wer sich an Marlene van Niekerks großen Roman Agaat aus dem Jahr 2004 erinnert, eine dichte Beziehungsgeschichte über eine Hausangestellte und ihre Herrin auf einer Farm in Südafrika, der dürfte sich auch erinnern, wie symbiotisch Hierarchien sein können und wie schwer es ist, denen, die keine Macht haben, eine Sprache und eine Stimme zu geben und ihre Geschichte zu erzählen. Niekerk zeigte aber auch, wie der Mikrokosmos einsamer, isolierter Lebenslinien die Geschichte eines ganzen Landes illustrieren kann, mit einer Wucht und Wahrheit, die bis heute gültig ist.
Die philippinische Autorin Caroline Hau geht einen ähnlichen Weg, um die zahlreichen Dilemmata der philippinischen Gesellschaft zu illustrieren, die so wie die südafrikanische Gesellschaft von jahrhundertelanger Kolonialisierung geprägt ist. Zwar ist Stille Im August, das bereits 2019 in den Philippinen unter dem Titel Tiempo Muerto veröffentlich worden ist, Haus Roman-Debüt, doch ist Hau keinesfalls ein „unbeschriebenes“ Blatt. Sie war bis zu ihrer Emeritierung in diesem Jahr Professorin für Südostasiatische Literatur am Center for Southeast Asian Studies der Universität Kyōto und hat sowohl literaturwissenschaftliche als auch historische Bücher veröffentlicht und wurde dafür sieben Mal mit dem wichtigsten philippinischen Literaturpreis, dem National Book Award ausgezeichnet. Auch Stille im August hat diesen Preis erhalten, und das zurecht. Denn wie Hau hier philippinische Geschichte mit der Gegenwart amalgamiert, erinnert auch an ihren komplexen Anspruch, dem manchmal allzu großen Schatten der philippinischen Literatur, José Rizal, gerecht zu werden, so wie etwa in ihrem auf Literatur.Review erschienenen Essay On Not Reading Rizal.
Rizal taucht in Haus Roman zwar nicht auf, aber dafür findet die Lesekultur der Philippinen Erwähnung, wo die einzigen Bücher, die gern gelesen werden, eben nicht die zwei Meisterwerke Rizals, sondern die Bibel und Kochbücher sind, und es inzwischen gar so weit gekommen ist, dass Bücher nicht einmal mehr als Wunderwaffe der politischen Trickkiste taugen, mit der man Wählerstimmen gewinnt. Die Erwähnung dieses kleinen Seitenhiebes ist wichtig, denn Haus Roman ist so wie Niekerks Roman auch ein höchst politischer Roman. Anders als in Niekerks ländlicher Einöde, tauchen bei Hau allerdings auch Politiker auf, greift ihr Roman grundsätzlich viel weiter um sich, denn es sind nicht nur die Philippinen, von denen Hau erzählt, sondern auch Singapur und die Hierarchien, denen die Filipino Overseas Workers (OFW) dort genauso ausgesetzt sind wie im eigenen Land:
Wir ausländischen Arbeiter sind wie Gespenster. Wir sind sichtbar und unsichtbar, drinnen und draußen, da und nicht da.
Wir leben mit Familien, ohne ein Teil von ihnen zu sein. Wir arbeiten zu Hause, ohne zu Hause zu sein, wir sind ans Haus gebunden und obdachlos. Wir verschwimmen mit den Möbeln und Wänden, verschwinden um Ecken, spielen in den Augen und Gedanken dieser Menschen kaum eine Rolle.
Wir wissen Dinge, die wir nicht wissen sollen: Männer, die ihre Ehefrauen betrügen, Zweitfamilien in China, verprügelte Frauen, missbrauchte Kinder, überstrenge Eltern, Söhne, die in Bordelle gehen, Töchter, die Selbstmordversuche unternehmen, missglückte Geschäftsabschlüsse, Geldstreitigkeiten, Teenager, die schwanger werden und abtreiben, Betrug bei Schulprüfungen, Geschlechtskrankheiten, Abhängigkeit von verschreibungspflichtigen Medikamenten, Glücksspiel und Pornos im Internet, Alkoholprobleme, Depressionen und Psychosen.
Damit zeigt Hau fast schon nebenbei, wie die kolonialen Strukturen von einst auch außerhalb der Philippinen wieder und wieder reproduziert werden. Doch sehr genau und das dann auch emotional unterlegt, erzählt Hau vor allem die Geschichte eines mysteriösen Verschwindens aus zwei völlig unterschiedlichen Frauenperspektiven: Zum einen der Perspektive von Racel, einer Hausangestellten aus Singapur, die von einer kleinen Insel auf den Philippinen stammt. Ihre Mutter betreute dort als Hausangestellte das Herrenhaus der reichen und mächtigen Familie Agalon. Als Racel erfährt, dass ihre Mutter seit einem Taifun verschwunden ist, erhält sie zwei Wochen Urlaub, um dort nach ihr zu suchen. Die zweite Perspektive ist Lias Perspektive, die zur selben Zeit von Singapur nach Manila und von dort weiter auf die Insel reist, auf der sich Racel schon befindet. Sie ist die Tochter der Agalons und wurde von ihrer Familie auf die Insel verbannt, um die Gerüchte über ihre Scheidung und ihre Affäre mit einem Fitnesstrainer zum Schweigen zu bringen. Beide Frauen waren sich in ihrer Kindheit sehr nahe, denn Racels Mutter war Lias Kindermädchen. Doch das halbschwesterliche Verhältnis ist lange vergessen, die Klassenunterschiede haben ihr Werk getan.
Hau verschränkt diese Ebenen so, wie die symbiotischen Beziehungen zwischen den Klassen es zulassen. Getrennt und doch miteinander in der Zeit fortschreitend. Über diese auch mit gespensterartigen Spannungselementen gefütterten Erzählebenen flechtet Hau nicht nur eine gnadenlose Beschreibung der Machtverhältnisse auf den Philippinen ein, wo sich seit der auch durch José Rizal befeuerten Revolution und Unabhängigkeit knapp 250 Familiendynastien die Macht aufteilen. Nein, sie zeigt auch genauso gnadenlos die Malaise der Beherrschten, die durch Sprache, Hautfarbe und Besitzverhältnisse konsequent ausgegrenzt werden:
Nach vielen Jahren in diesem Land erkenne ich rasch, wo unsichtbare Zäune die Hausangestellten und Arbeiter von öffentlichen und privaten Plätzen fernhalten sollen. Hier ist es nicht anders als in Manila, wo wir nach unserer Hautfarbe beurteilt werden, dem Zustand unserer Zähne, nach unserer Sprache, unserem Dialekt, unseren Kleidern und Schuhen, danach, wie wir gehen und stehen, nach dem, was wir essen, nach den Vierteln, die wir mit Beschlag belegen, den Menschen, die unsere Verwandten und Freunde sind.
Der Monat der Untätigkeit, der Monat, wenn das Zuckerrohr wächst und der einst die Zuckerrohrbauern bis in die Grundfesten erschütterte, und der im Originaltitel von Haus Buch als „tote Zeit“ (Tiempo Muerto) beschrieben wird, erstreckt sich in Haus Roman inzwischen auf das ganze Jahr. So wie Niekerk ihre Farm als exemplarischen Mikrokosmos nutzt, um mit dem Kleinen das Große zu erklären, so steht auch bei Hau die Insel für ein ganzes Land, das unter Nepotismus und Korruption ächzt, von allen guten Geistern, Gespenstern (und Menschen) verlassen und im Grunde gestorben ist.
Es sind dann auch die Gespenster, die letztendlich den einzigen Hoffnungsschimmer in Haus so klugem wie berührendem Roman bieten. Die Gespenster einer Revolution, die vielleicht doch noch in den Bergen existiert und vielleicht gar die finale Schändung des Landes – in Haus Fall der Ausverkauf der Insel als internationales Luxusresort – verhindern kann. Und dann ist da noch die Hoffnung, dass auch die Toten und ihre Seelen vielleicht die Fähigkeit gewinnen, sich aus einem Land davonzumachen, das nicht mal mehr als Begräbnis- und Ruheort der Seelen taugt, um sich im Exil mit den Lebenden, den politisch Exilierten und den vielen Wirtschaftsmigranten zu vereinen.
Hat Ihnen dieser Text gefallen? Dann unterstützen Sie doch bitte unsere Arbeit einmalig oder monatlich über eins unserer Abonnements. Wir würden uns freuen!
Wollen Sie keinen Text mehr auf Literatur.Review verpassen? Dann melden Sie sich kostenlos für unseren Newsletter an!



