Reiche Frauen, dumme Männer

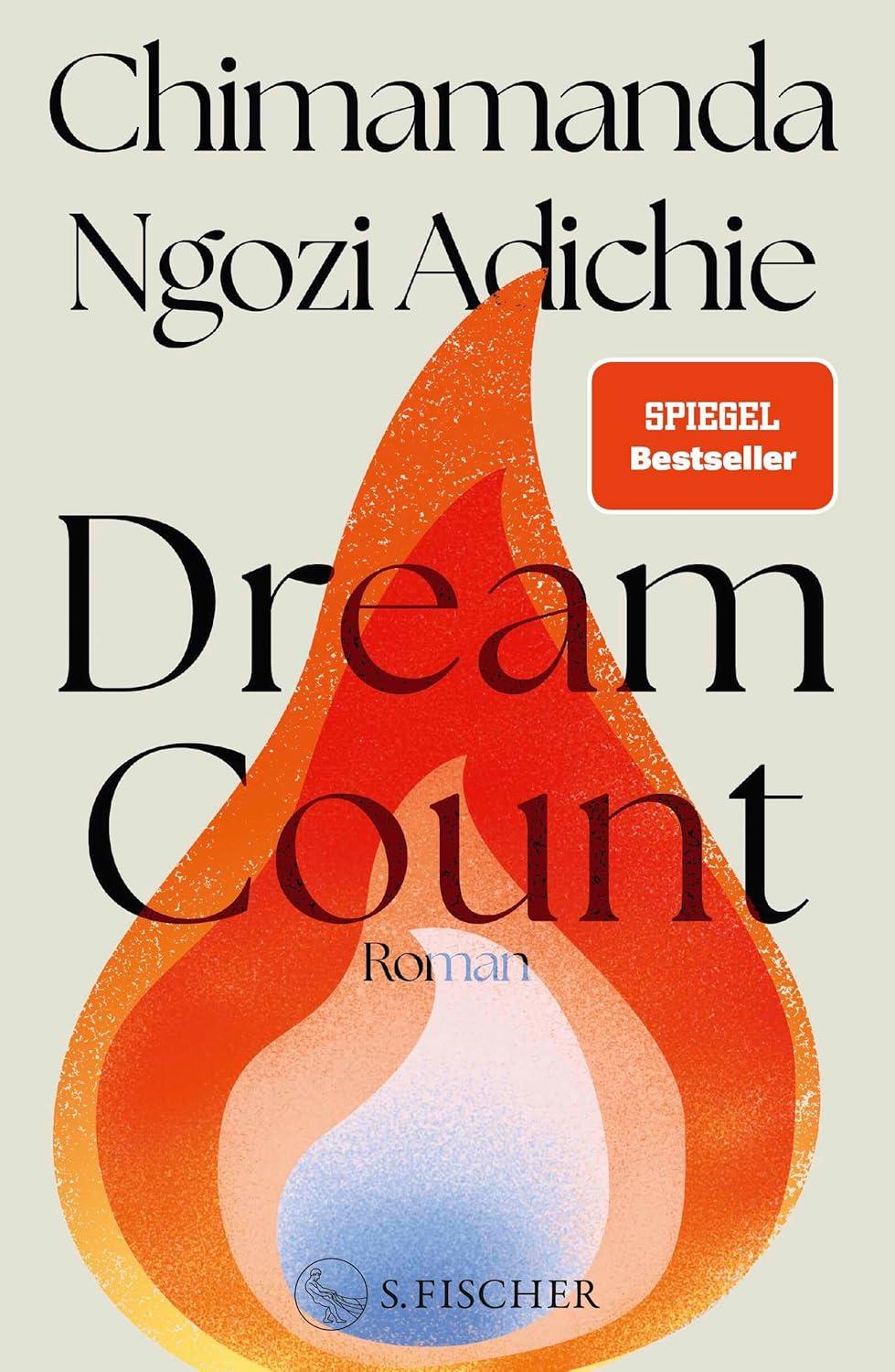 Fischer Verlag
Fischer VerlagChimamanda Ngozi Adichie | Dream Count | Fischer | 528 Seiten | 28 EUR
The whole idea of a stereotype is to simplify. Instead of going through the problem of all this great diversity - that it’s this or maybe that - you have just one large statement; it is this. – Chinua Achebe
Weniger durch ihre ersten drei Romane als durch ihre legendären TED-Talks ist die nigerianisch-amerikanische Autorin Chimamanda Ngozi Adichie inzwischen zu einer der zentralen Gestalten postkolonialer feministischer Literatur geworden. Hatten ihre dichten und hervorragend komponierten Romane Purple Hibisus (2001), Half of a Yellow Sun (2006) und Americanah (2013) noch Identitäts-, Religions- und Migrationsfragen im Fokus westlicher und nigerianischer Igbo-Kultur behandelt und wurden historische Verwerfungen wie der Biafrakrieg sowie Gender-Diskurse in dichte, emotionale Geschichten eingebettet, begann sich Adichie nach zahlreichen Preisen und Ehrungen neu zu orientieren. In TED Talks wie We Should All Be Feminists (2012), der nicht nur von Beyoncé gesampelt, sondern 2016 auch auf einem T-Shirt von Dior zitiert wurde, inszenierte sich Adichie mehr und mehr als modebewusste Aktivistin mit Popstarqualitäten.
Den Höhepunkt und vielleicht ja auch Abschluss dieser Entwicklung bildet ihr neuer Roman Dream Count, der Anfang März 2025 zeitgleich in mehreren Sprachen veröffentlicht wurde; eine Ehre, die nur wenigen Autoren:innen widerfährt, so wie etwa kürzlich auch einer anderen Großautorin unserer Gegenwart, Sally Rooney und ihrem Roman Intermezzo.
Anders als Rooney, deren Liebes- und Lebenserkundungen allein in Irland angesiedelt sind, ist Adichies Roman ein internationales Buch, das schon wie Adichies Americanah sowohl in Nigeria als auch den USA angesiedelt ist. Damals erzählte Adichie noch von jungen Menschen im Aufbruch und mit völlig unterschiedlichen Migrationserfahrungen und vor allem über eine am Ende erfüllte Liebesgeschichte. 12 Jahre später ist nun alles anders. Nicht nur ist Adichie älter geworden, auch ihr Personal ist gealtert und mit ihnen haben sich die Lebensverhältnisse gravierend verändert. Die in Adichies früheren Romanen stets wichtigen politischen und historischen Verhältnisse sind in ihrem neuen Text nahezu verschwunden, sieht man einmal von den politischen Implikationen der Covid-Pandemie ab, die den historischen Rahmen von Dream Count bildet oder ein paar Korruptionsexkursen. Am stärksten wird der Lauf der Zeit jedoch an Adichies Personal deutlich – drei wohlhabenden Frauen um die 40, die man vielleicht am besten als "Afropolitans" bezeichnen kann. Ein Begriff, den Taiye Selasi 2005 in ihrem Essay Bye-Bye Babar und 2013 mit ihrem Roman Ghana Must Go geprägt hat und jene wohlhabenden Afrikaner - oder Menschen mit Wurzeln in Afrika - meint, die in Amerika, England oder Paris studiert haben und auf der ganzen Welt zu Hause sind. Und einer im Dienstleistungssektor arbeitenden Frau, deren Ursprungsheimat ebenfalls Nigeria ist, die aber nicht unterschiedlicher sein könnte. Doch zwei Dinge haben sie gemein: sie sind miteinander befreundet und sie haben alle Pech mit Männern.
Adichie verwebt diese Geschichten allerdings nicht zu einem konsistenten Narrativ, sondern erzählt ihre Geschichte mit wechselnden Perspektiven. Jede der vier Frauen – Chia(maka), die Reiseschriftstellerin, ihre alten Freundinnen Zikora und Omelogor und die als Haushälterin bei Chia angestellte Kadiatou – erhält auf knapp hundert Seiten „ihre“ Geschichte. In einem finalen Kapitel ist es dann noch einmal Chia, aus deren Perspektive das Ende der Pandemie und die großen Dramen im Leben der Frauen abgewickelt werden.
Diese Dramen drehen sich bei Chia, Zikora und Omelogor im Kern um unerfüllte Liebe und dumme, rücksichtslose oder einfach nur ignorante Männer, die weder den modernen, feministischen Ansprüchen der Frauen noch den Ansprüchen entsprechen, die den Frauen über ihre noch nigerianischen Werten verbundenen Eltern angetragen werden. Vor allem der unerfüllte oder tragisch erfüllte Kinderwunsch wird über Eltern-Töchter-Dyaden intensiv aufbereitet. Gleichzeitig versucht Adichie kolonialhistorische Akzente zu setzen, indem sie etwa einen von Chias Partnern, einen afro-amerikanischen Wissenschaftler Chia vorwerfen lässt, dass ihre Igbo-Vorfahren seine Vorfahren sehr wahrscheinlich als Sklaven verkauft hätten. Doch diese berechtigten historischen Diskurse sind dünngesät und verlieren durch stereotype und oberflächliche Erkenntnisse schnell ihre Wirkung:
“The problem is that many of these White people don’t think we also dream,” he said.
I stared at him, astonished. “Yes,” I said. “Yes, exactly.”
Mehr als für Historie interessiert sich Adichi in ihrem neuen Roman für laue Liebesgeschichten, die trotz ihrer Überfülle bei allen Frauen stets tragisch ausgehen. Das erinnert an TV-Serienformate wie Desperate Housewife’s und Sex and the City, nicht zuletzt durch den repetitiven Charakter der Geschichten, denen jegliche Ambivalenz fehlt und die in ihrer Eindeutigkeit dann auch langweilen. Vor allem auch, weil die Moral der Geschichte im Kern stets die gleiche ist, und die Adichie seit ihrem TED Talk We Should All Be Feminists und der Auskoppelung in einen gleichnamigen Essay 2014 immer wieder rekapituliert: Mehr Feminismus wagen, damit sich die Welt endlich ändert.
Ihren wohl situierten Heldinnen nimmt man das Leiden am Leben und den Wunsch nach einer veränderten Welt allerdings nur selten ab. Und das Geld nun einmal nicht glücklich macht, ist ein so abgedroschenes Sprichwort, dass man es nicht auch noch auf jeder Seite eines über 500 Seiten langen Romans lesen möchte. Adichie versucht allerdings, durch die Figur von Kadiatou die redundanten Lebenspiroutten ihres wohlhabenden Stammpersonals zu erweitern und entwirft eine Figur der Unterklasse, die nicht nur in ihrer Heimat Nigeria schweres Leid erfahren muss, sondern dann auch in ihrer neuen Heimat, den USA. Adichie verzwirbelt hier sehr frei die Geschichte des Zimmermädchens Nafissatou Diallo, das von dem französischen Politiker Dominique Gaston André Strauss-Kahn in einem New Yorker Hotel sexuell missbraucht worden ist, mit der Lebenslinie ihrer Heldin. Das wirkt zwar wie ein aufgesetzter Fremdkörper in der Erzählung und kommt nicht einmal in Ansätzen an die Intensität des ebenfalls mit viel Leid und ähnlichen Motiven unterlegten Coming-of-Age- Romans The Girl with the Louding Voice von Abi Daré heran, bietet aber endlich einmal einen kleinen Funken jenes Sozialrealismus, der Adichies frühe Romane noch grundiert hatte und der hier größtenteils für eine Geschichte über reiche Menschen geopfert wird, die sich bestenfalls mit ihrem privaten Koch darüber streiten, wie wichtig es ist, nationale Identität über indigene Küche zu bilden. Oder halt ihrer Haushälterin im Kampf gegen amerikanische Anwälte und lügende Medien beistehen. Oder die dann doch ein Kind bekommen, auch wenn der Mann es nicht will. Das wirkt angesichts der drei großen Wellen der Frauenbewegung arg verstaubt, vor allem wenn dann auch noch Phrasen auftauchen, die in ihrer Banalität kaum zu überbieten sind:
„There was no wavering will, no fear. We are in love and then we are not in love. Where does love go when we stop loving?“
Die Antwort ist eine, die an Joseph Conrad und seinen Lord Jim erinnert: "Dem Traum folgen, immer wieder dem Traum folgen..." Bei Adichie ist es allerdings eine Alternative von einem anderen Leben, von der geträumt werden soll: “BUT SERIOUSLY, don’t you ever dream of an entirely different life?” Ein Satz, der so wichtig ist, wie der Titel ihres Romans, der natürlich auch eine subtile Anspielung den militärischen Begriff des „Body Counts“ ist und vielleicht auch verdeutlichen soll, dass die Geschlechter sich im Krieg befinden und das Träumen deshalb umso wichtiger ist. Wie diese Träume allerdings aussehen könnten, davon erzählt Adichies im Grunde nichts. Denn trotz aller Wechsel im Leben ihrer Heldinnen, ist nicht nur die Vision von Kadiatou und ihrer Tochter am Ende eine schale, feige, ja fast schon kitschige Vision eines neuen Lebens und einer neuen Zeit.
Wer sich nach befriedigenderen, aufregenderen und visionäreren Ideen sehnt, sollte deshalb Adichies Roman beiseite legen und zu Tlotlo Tsamaases afro-futuristischer Dystopie Womb City greifen, in der eine wahrhaft post-feministische Heldin zu neuen Welten und einem erfrischend neuen Denken aufbricht.



