Das Glas ist halb voll

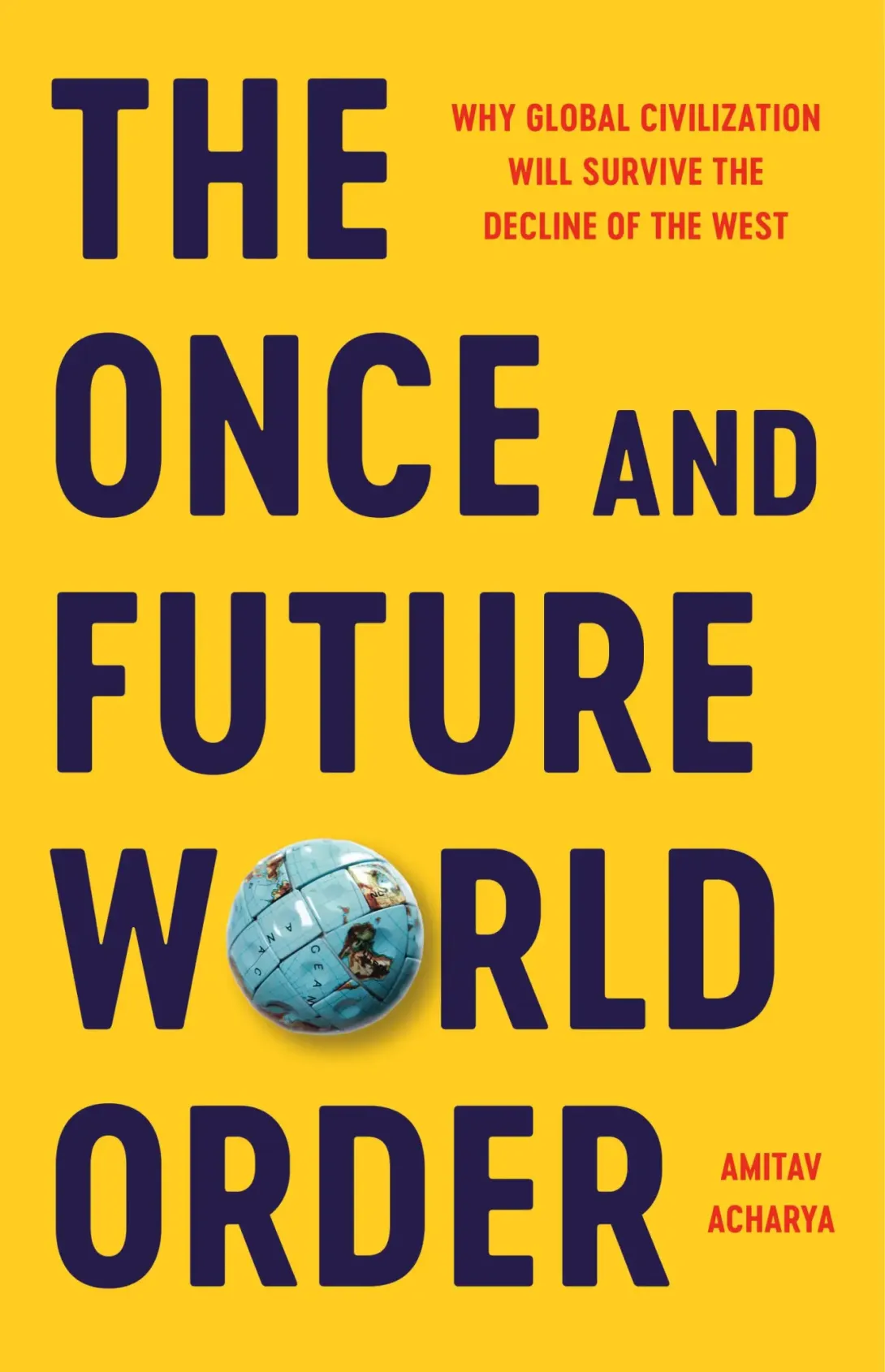 Basic Books
Basic BooksAmitav Acharya | The Once and Future World Order: Why Global Civilization Will Survive the Decline of the West | Basic Books | 464 Seiten | 32.50 USD
Der indische Politikwissenschaftler Amitav Acharya ist „distinguished professor“ für Internationale Beziehungen an der American University in Washington DC und Inhaber des UNESCO-Lehrstuhls für „Traditionelle Herausforderungen und Governance“. Er wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Im April dieses Jahres veröffentlichte er das Buch The Once and Future World Order: Why Global Civilization will survive the Decline of the West bei Basic Books UK. Schon 2014 hat er das Buch The End of the American World Order veröffentlicht.
Amitav Acharya teilt die Welt in „The West“ und „The Rest“. Sein großes, alles überwölbendes Anliegen in seinem neuen Buch ist es darzulegen, dass der Westen seine Kultur und seine Weltordnung nicht aus sich selbst heraus geschaffen hat, sondern das praktisch alle historischen Zivilisationen die „Westliche Zivilisation“ beeinflusst haben. Was für – sagen wir einmal für vorurteilsfreie (falls es so etwas überhaupt gibt) und gebildete Menschen eine Binsenweisheit ist – muss dem „Westen“ doch immer wieder kräftig unter die Nase gerieben werden, ganz einfach deshalb, weil den meisten Europäern und US-Amerikanern aus der Vergangenheit, in der sie den anderen Ländern auf dieser Welt oft um Meilen voraus waren, ein Überlegenheitsgefühl zu einem festen Bestandteil ihrer Identität gemacht haben, von dem sie in der Regel weder lassen können noch lassen wollen. Der Autor schreibt aber genauso für „The Rest“. Seine Botschaft: Niemand muss sich vor dem „Westen“ klein machen, jeder hat Gründe genug, stolz auf die Leistung seiner Zivilisation zu sein. Ich stimme ihm in diesem Punkt von ganzem Herzen zu.
Amitav Acharya betont, dass man beim Lesen des Buches seine Definition von Weltordnung beachten muss. Es geht nicht um die ganze Welt, sondern eher um Zivilisationen, die mehr oder weniger große Teil der Welt beherrscht haben. So ist das Römische Reich genauso eine Weltordnung wie das alte Indien, China oder das Mali Reich unter Mansa Musa im 14. Jahrhundert in Westafrika, um nur einige Beispiel zu nennen.
Sein Streifzug durch die Geschichte der Weltordnungen beginnt im alten Sumer, Babylonien und Ägypten. Von diesem Startpunkt aus arbeitet er sich konsequent durch alle großen Spieler der Weltgeschichte auf allen Erdteilen bis in unsere Gegenwart vor. Für jemand, der sich schon mit diesen spannenden historischen Themen befasst hat, bringen seine Überblicke im Grunde nichts Neues, sein immer wieder durchscheinendes Detailwissen ist jedoch beeindruckend. Darüber hinaus ist der geballte Überblick ein großer Wert an sich. Etwas überraschend war für mich, dass Amitav Acharya nicht erwähnt hat, dass die Sieben-Tage-Woche und die Zeiteinteilung in 24 Tagesstunden mit einer Stunde à 60 Minuten und einer Minute à 60 Sekunden von den Babyloniern auf der Grundlage sumerischer Erkenntnisse entwickelt wurde.
Bei jeder Weltordnung, die er bespricht, geht es ihm darum, aufzuzeigen, welche Elemente für seine Weltordnung der „Westen“ von anderen übernommen hat, bzw. die andere Zivilisationen schon lange vor dem Westen entwickelt hatten. Für einen Hochmut des Westens gegenüber „The Rest“ besteht kein Anlass. Immer geht es ihm darum, dem „Westen“ klar zu machen, dass er sich für sein Überlegenheitsgefühl und die brutalen Methoden seiner Eroberungen in Grund und Boden schämen sollte und dass sich „The Rest“ mit Recht gegen „The West“ wehrt und dabei ist, langfristig wieder die Führung in der Welt zu übernehmen. Hier ist ein Punkt, an dem ich als Deutscher und Europäer um eine Kritik nicht herumkomme.
Mit dem Aufstieg von „The Rest“ bin ich dabei vollkommen einverstanden. Persönlich hatte ich das Glück, im Januar 2002 auf einer ganzen Seite in der Münchner Abendzeitung meine Einordnung der Anschläge auf das World Trade Center in den USA darzulegen. Die Überschrift meines Essays lautete „Das Ende des Amerikanischen Jahrhunderts“. Also liege ich ganzauf der Linie von Amitav Acharya. Mich hat beim Lesen gestört, dass sich bei mir immer wieder das Gefühl einschlich, als sollte ich mich persönlich bei den anderen Zivilisationen entschuldigen und bedanken. Zum Beispiel bei den Indern, die die Null erfunden haben, was ich persönlich seit Jahrzehnten als eine der größten Leistungen in der Geschichte der Menschheit ansehe. Was mich stört, ist, dass die Leistungen des „Westens“ immer wieder auf eines reduziert werden: auf rohe Gewalt, räuberische Kolonisierung, Rassismus und Ungerechtigkeit. Und das, obwohl der Autor keinen Zweifel daran lässt, dass alle Zivilisationen sowohl Mitleid wie Grausamkeit verkörpern. Der Mensch kann eben nicht nur gut, sondern auch abgrundtief böse sein.
Ich hätte mir gewünscht, dass der Autor, so wie bei allen anderen Zivilisationen auch, bei der westlichen Zivilisation über ihre Errungenschaften gesprochen hätte. Sie kommen fast gar nicht vor. In der Renaissance, als Europa ab dem 14. Jahrhundert sein römisch-griechisches Erbe wiederentdeckte, sagten manche „Wir sind Zwerge, aber wir stehen auf den Schultern von Riesen“. Das Gleiche gilt für unsere heutige Welt. Es waren die Europäer, die die Erde für alle zur Kugel gemacht und die Sonne ins Zentrum des Planetensystems gesetzt haben. Es waren die Europäer, die die wissenschaftliche Zivilisation entwickelt haben, die heute jede Kultur auf dieser Welt durchdringt. Und es waren die Europäer, die mit ihrer Wissenschaft den Grund für die steigende Lebenserwartung der Menschen gelegt haben. Ohne die weltweite Verbreitung amerikanischer Nutzpflanzen, ohne die Entwicklung moderner Düngung (Synthetisierung von Ammoniak) sowie der wissenschaftlichen Medizin würde heutzutage höchstwahrscheinlich die Anzahl der Menschen auf diesem Planeten weit weniger als die Hälfte betragen.
Im letzten Kapitel blickt Amitav Acharya vorsichtig in die Zukunft. Er geht auf die Angst der Amerikaner und Europäer ein, die ihren relativen Abstieg sehr wohl wahrnehmen und deshalb Angst haben. Er ruft den „Westen“ auf, die Tatsachen anzuerkennen, demütiger zu sein und endlich seinen Hochmut aufzugeben. Dem ist nichts hinzuzufügen. Der Autor glaubt fest daran, dass wir alle Chancen haben, eine bessere, eine gerechtere Weltordnung zu errichten. Sein Optimismus ist mir sehr willkommen. Dieses Mal sollte es meiner Meinung nach am besten eine Weltordnung der ganzen Menschheit sein. Auch wenn es im Moment nicht danach aussieht, brauchen wir diese, um die Chance zu haben, globale Herausforderungen wie den Klimawandel oder auch die Entwicklung künstlicher Intelligenz zu bestehen. Das Glas ist halbvoll. Diese Einstellung sollten wir alle beherzigen. „The West“ genauso wie „The Rest“.



