Wie Erzählungen beginnen und Vergangenes neu Gestalt annimmt

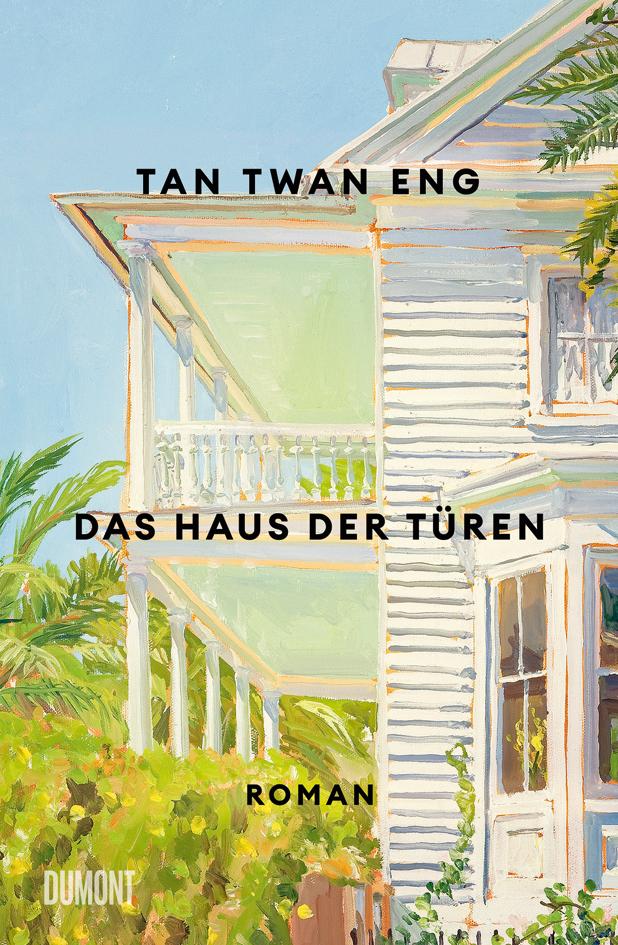 DuMont
DuMontTan Twan Eng | Das Haus der Türen | DuMont | 352 Seiten | 24 EUR
„Wir waren für ihn wahrscheinlich das langweiligste Ehepaar, das er kannte.“ Wenn sich eine Romanfigur gleich zu Beginn einer Geschichte selbst als langweilig bezeichnet, ist die Neugier geweckt. Man fragt sich unweigerlich, weshalb der Autor sie dennoch interessant genug findet, um über sie schreiben zu wollen. Im Fall von Lesley Hamlyn, der Hauptfigur von Tan Twan Engs drittem Roman Haus der Türen, stellt sich diese Frage gleich doppelt.
Die Hamlyns bekommen nämlich im Jahr 1921 Besuch aus Europa: Der Schriftsteller William Somerset Maugham verbringt mehrere Wochen im Haus der Hamlyns auf der Insel Penang an der Westküste Malaysias, damals Teil des Britischen Empires. Maugham, ein alter Freund von Lesleys Ehemann Robert, ist zu dieser Zeit bereits ein gefeierter Autor, und die Hamlyns sonnen sich gerne in seinem Ruhm.
Tan Twan Eng erzählt in seinem Roman, wie sich Maugham während dieses dreiwöchigen Aufenthalts zunehmend für Lesleys Geschichte interessiert und sie schließlich sogar in eine seiner bekanntesten Erzählungen The Letter einfließen lässt.
Zunächst aber ist Lesley für den Schriftsteller nur die jüngere Ehefrau eines alten Freundes, eine freundliche, aber auch etwas unterkühlte Gastgeberin. Auch Maugham selbst ist zu Beginn der Handlung vor allem mit eigenen Sorgen beschäftigt: Da ist zunächst einmal seine Ehefrau, die mit der gemeinsamen Tochter in London zurückgeblieben ist. Die Ehe ist längst zerrüttet und Maugham nutzt jede Chance, um nicht in London sein zu müssen. Lieber reist er mit seinem Sekretär und Geliebten Gerald durch Südostasien. Nur hier kann er in relativer Freiheit so leben, wie er es will, zu Hause wäre das kaum möglich. Denn seit dem Prozess gegen Oscar Wilde kennt die britischen Öffentlichkeit zwar ein Wort für die gleichgeschlechtliche Liebe, Homosexualität, doch Wildes Verurteilung hat die Furcht vor einer gesellschaftlichen Bloßstellung bei den Zeitgenossen nur noch weiter ansteigen lassen. Das freie Leben fernab Londons kann Maugham allerdings nur führen, solange das Geld reicht. Nach einer missglückten Investition ist gerade das seine zweite große Sorge. Er steht daher unter großem Druck, bald wieder ein Buch zu veröffentlichen.
Tan Iwan Eng lässt sich viel Zeit, die schrittweise Annäherung zwischen Maugham und Lesley Hamlyn zu erzählen. Doch der Roman braucht diese erzählerische Ruhe und Langsamkeit, um ihre Annäherung glaubhaft wirken zu lassen. Sie gelingt schließlich, weil beide Figuren trotz äußerem Komfort unter ähnlichen Zwängen und gesellschaftlichen Erwartungen leiden. So führt Lesley zwar an der Oberfläche ein Leben, das von der Frau eines Anwalts erwartet wird: Musikabende, Tennisspielen, Kirchenchor, Clubmitgliedschaften und Wohltätigkeitsarbeit. Die Söhne werden in englischen Internaten erzogen und die vielen Bediensteten ermöglichen ein komfortables Leben. Und Maugham stellt schon bald fest, dass Lesley sich von den anderen Frauen der britischen Kolonialgesellschaft unterscheidet. Sie wurde in Penang geboren und ist mit der Kultur vertraut, vor allem durch ihr Kindermädchen, ihre Amah Ah Peng. Sie spricht die Sprache der Einheimischen, Hokkien, und kann sich auch auf malaiisch verständigen. Und sie nimmt rege Anteil an der wechselvollen Geschichte Penangs, einer Insel, die im frühen 20. Jahrhundert zwar unter britischer Verwaltung steht, zugleich aber ein Schmelztiegel ethnischer Gruppen ist. Eine Zeit lang dient Penang sogar den chinesischen Tongmenghui als Hauptquartier, von dem aus sie die Revolution im kaiserlichen China organisieren.
Lesleys scheinbar bescheidener Satz vom Beginn des Romans entpuppt sich somit als Teil einer überlegten Haltung. Sie durchschaut genau, wie schmal der Grat weiblicher Freiheit ist und wie schnell ein Fehltritt den Ausschluss bedeuten kann. Sie ist eine berührende und kluge Figur, die sich immer im Griff haben muss und die doch hohe Risiken eingeht bei dem Versuch, dem eigenen Leben Sinn und Zweck zu verleihen.
Tan Iwan Eng sagte 2023 in einem Interview, er interessiere sich besonders für Lücken und Leerstellen in Geschichten. Und tatsächlich geht es in seinen Roman, der es wie seine Vorgänger auf die Longlist für den Bookerpreis geschafft hat, um ein Ausloten solcher Leerstellen. So verbrachte etwa Somerset Maugham bei einer seiner zahlreichen Reisen durch Südostasien wirklich einige Wochen in Penang, der Insel, von der auch der Autor Tan Twan Eng stammt. Doch weder hat Maugham die Insel je literarisch verewigt, noch sind Tagebuchaufzeichnungen erhalten. Hier kann Tan Iwan Eng ansetzen: Er füllt die Lücken mit seiner Vorstellungskraft und erzählt von einer längst untergegangen Welt, vom Schweigen und Verschweigen, aber auch vom Wunsch nach Selbstbestimmung.
Er versteht es dabei sehr subtil, die koloniale Welt so zu schildern, dass sie die Perspektive der Zeitgenossen zeigt, aber zugleich Distanz zu ihr herstellt. So erzählt er etwa von einem Ausflug, den Maugham mit seinem Gastgeber auf den Gipfel des Penang Hill macht, der sich oberhalb der Stadt Penang erhebt. Wer dort im Jahr 1921 hinaufwollte, musste zu Fuß gehen. Die Standseilbahn, die noch heute existiert, wurde erst 1924 eröffnet. Somerset Maugham und sein Gastgeber müssen jedoch nicht selbst die mühsame Steigung erklimmen, sondern nehmen jeweils in einer Dhooly Platz, einem Korbsessel, an dem zwei Bambusstangen befestigt sind und der von vier einheimischen Männern getragen wird. Am Gipfel angekommen, wird jedoch nur die Perspektive der beiden Europäer erzählt, die sich nach dem anstrengenden Geschaukel erst einmal erholen müssen. Die viel größere Anstrengung der acht Männer, die sich für ihren Ausflug haben abmühen müssen, wird von den beiden weder wahrgenommen noch gewürdigt. Mit solchen Szenen gelingt es Tan Twan Eng beinahe nebenbei, die koloniale Wirklichkeit sichtbar zu machen, ohne sie direkt anzuprangern. Vielmehr zeigt er so die Selbstverständlichkeit und Blindheit der britischen Dominanz, die sich selbst kaum in Frage stellt. Gerade diese Zurückhaltung macht die erzählerische Leistung des Romans aus.
Wie ein Spiegel nimmt Haus der Türen Schauplätze, Figuren und Geschichten aus Maughams Werk auf, doch statt sie nur zu reflektieren, verschiebt der Roman den Blick und lässt neue Facetten aufscheinen. Und am Ende macht er sogar Lust, Maughams Erzählungen und Romane neu zu entdecken oder wieder zu lesen.
Hat Ihnen dieser Text gefallen? Dann unterstützen Sie doch bitte unsere Arbeit einmalig oder monatlich über eins unserer Abonnements. Wir würden uns freuen!
Wollen Sie keinen Text mehr auf Literatur.Review verpassen? Dann melden Sie sich kostenlos für unseren Newsletter an!



