Nach der Lektüre von Tajimara

Rodolfo Lara Mendoza ist ein kolumbianischer Schriftsteller. Er hat den Kurzgeschichtenband (Editorial UIS, 2016; Cero Squema Editores, 2022) und die Gedichtbände Esquina de días contados (Pluma de Mompox 2003), Y pensar que aún nos falta esperar el invierno (Pluma de Mompox 2011) und Alguna vez, algún lugar (Turpin Editores, 2018) veröffentlicht, letzterer auch enthalten in der in Spanien erschienenen Sammlung Palabra de Johnnie Walker.
Ich weiß nicht, welcher obskure Mechanismus mich von einer Erzählung von García Ponce zu einer alten, vergessen geglaubten Episode geführt hat, noch welche Bedeutung sie heute haben könnte. Auch wenn es in der Regel umgekehrt ist, gibt es Wege, die in Büchern beginnen und im Leben enden.
Die Erzählung trägt den Titel „Tajimara“, und vielleicht führte mich die Lektüre in die Vergangenheit zurück, weil sie aus einem Auto heraus erzählt wird. Nachdem ich sie gelesen hatte, sah ich mich selbst wieder, als das stumme Kind, das in dem Bus saß, in dem mich ein Nachbar zur Schule mitnahm. Es war ein gelber Bus, dazu bestimmt, die Werktätigen eines öffentlichen Amts zu befördern. An einem regnerischen Morgen sah ich von einem der Sitze aus jene „sich im Wind wiegenden Tannen, die braunen Berge und den grauen, verwaschenen Himmel“ wie der Erzähler von „Tajimara“, obwohl es in meiner Stadt keine Tannen gibt und nur einen kleinen Hügel, dessen Vegetation mit zunehmender Trockenheit verblasst.
Das war in den 1980ern. Ich wohnte in einem Viertel der Vorstadt. In einer Straße mit neunzehn Häusern, die klein waren, aber nicht so die Seelen, die in ihnen wohnten. Ich könnte sie einzeln aufzählen und der Zeit, die sich anschickt, sie auszulöschen, ein Schnippchen schlagen. Ich könnte meine Hände in diese Fabrik des Vergessens strecken und wie wild versuchen, sie vor dem Tod zu retten. Ihre Leben neu erschaffen, ihre Lieben wieder zum Leben erwecken ... Ist es nicht das, was Literatur macht?
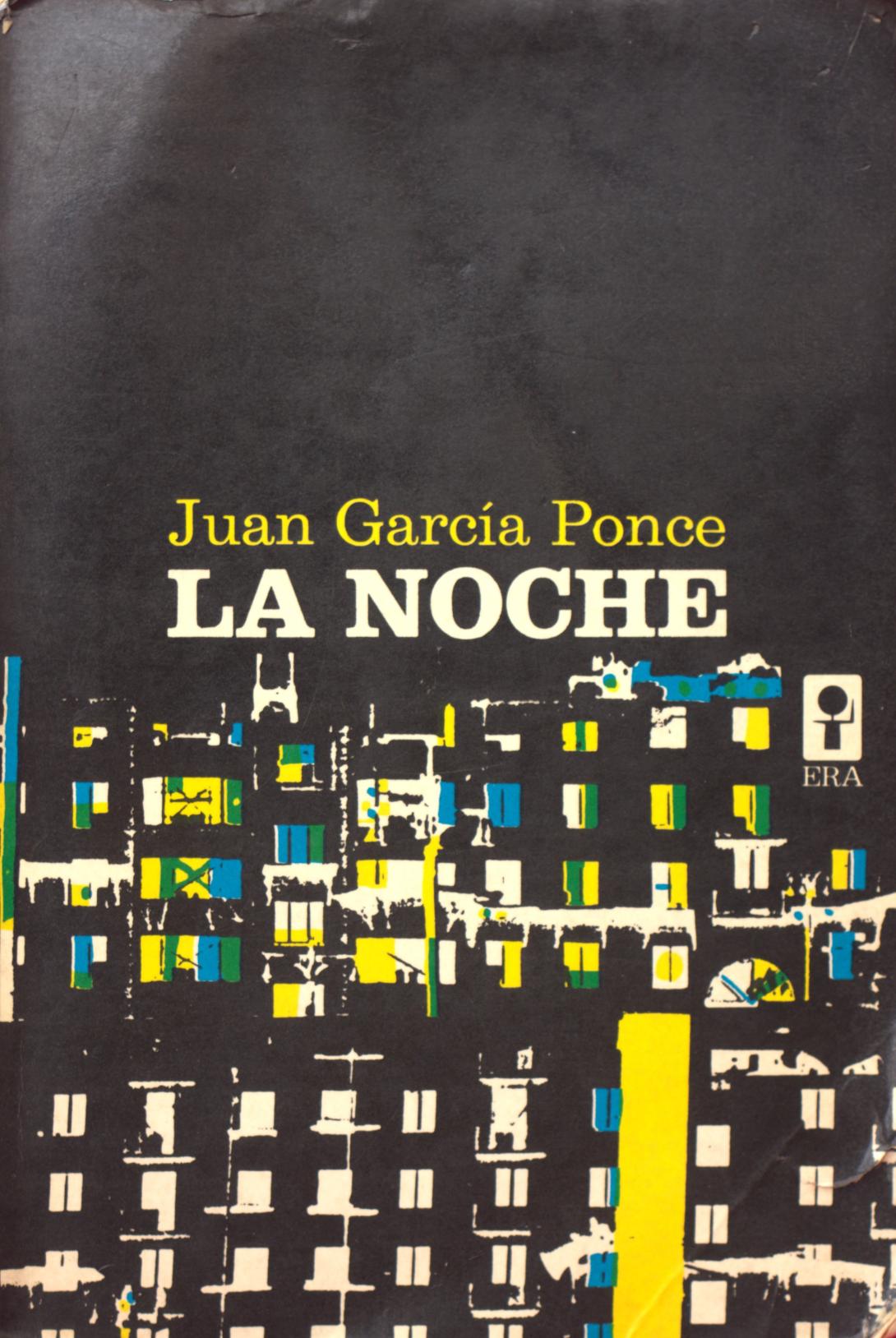 ERA
ERAJuan García Ponce | La Noche | ERA | 87 Seiten | 6,56 USD
„Tajimara“, enthalten in dem 1963 erschienenen Band mit Kurzgeschichten mit dem Titel La noche, beleuchtet die Hassliebe zwischen dem Erzähler und Cecilia, ihre Begegnungen und Missverständnisse und das „ewige dumme Spiel“, dem er sich hingibt: „Verrückter egoistischer Masochist, der die ideale Partnerin gefunden hatte“. Zeile für Zeile präsentiert uns die Geschichte eine Bestandsaufnahme der Wunden. An einem regnerischen Nachmittag, während er von Cecilia zu einer Feier in einer Stadt außerhalb von Mexiko-Stadt namens Tajimara gefahren wird, erinnert sich der Erzähler an die Male, als er mit ihr zum Atelier von Julia und Carlos gefahren ist, einem Geschwisterpaar, zwischen dem es Inzest zu geben schien. Während er Cecilia zuhört, kehrt er in die Jahre zurück, in denen er sich in sie verliebt hatte, und in die Zeiten, in denen er sie vergessen zu haben glaubte und sie nach einer Weile wieder auftauchte, um seine Gefühle erneut durcheinanderzubringen:
Früher waren Cecilia und ich diese zwanzig Kilometer schon unzählige Male gefahren; aber die Landschaft war mir nie so melancholisch vorgekommen wie jetzt. In gewisser Weise war es geradezu symbolisch, dass immer sie gefahren ist. Ich hatte mich mein ganzes Leben lang nach ihrem Willen gerichtet, und als sie sich nach sechs Monaten, in denen ich sie nicht zu Gesicht bekommen hatte, plötzlich wieder bei mir meldete, um mich wieder nach Tajimara einzuladen, hatte ich nicht einmal Zeit, über meine Gefühle nachzudenken, ich nahm einfach an, wohl wissend, dass ich nie Gewissheit haben würde, ob ich sie liebte oder hasste.
Vier Jahre nach der Veröffentlichung von „Tajimara“, im Jahr 1967, wird bei García Ponce Multiple Sklerose diagnostiziert. Sein Leben würde fortan an einem seidenen Faden hängen. Nach und nach verliert er seine motorischen Fähigkeiten. Sein Sprechen, das bis dahin flüssig war, verlangsamt sich und gleitet ins Obskure ab, wird unbeholfen und abgehackt. Mit dem, was ich hier schreibe, ist es wie mit seiner Stimme: eine Geschichte, die vorankommen will und sich in den Lücken meiner Erinnerung festsetzt.
Ich weiß nicht, ob ich diesen Bus während der sechs Jahre High School zwischen 1985 und 1990 genommen habe. Jedenfalls hätte ich ihn nehmen sollen: Es herrschte Mangel, und der Nachbar hat mir nichts berechnet. In jenen Jahren geschahen in meinem Land schreckliche Dinge. Der Ausbruch des Vulkans Nevado del Ruiz. Die Besetzung des Justizpalastes. Die Ermordung des Herausgebers von El Espectador, Guillermo Cano. Die Tragödie von Villatina. Der Autobombenanschlag auf das DAS-Gebäude. Die Ermordung der Präsidentschaftskandidaten Bernardo Jaramillo Ossa, Luis Carlos Galán und Carlos Pizarro Leongómez. Und inmitten dieser Ereignisse die Rückkehr meines Vaters. Meine Reaktion darauf war schlimm. Nach der Trennung von meiner Mutter hatte er die Stadt verlassen, und da kam er eines Tages einfach zurück auf Besuch. Als ich davon erfuhr, versteckte ich mich im Hof. Lange Zeit verharrte ich unter meinen Hühnern. In diesem Verhalten lag etwas von García Ponce. Als er gefragt wurde, warum er immer schwarz trage, antwortete er, eine Figur aus Tschechow zitierend: „Ich trauere um mein Leben“. Ich habe immer Farben getragen und in meiner einzigen monochromen Phase eher Weiß. Denn bei der Trauer, wie bei einer Prozession, geht es nach innen. „Hinter jeder Sünde steht ein Sünder, der sich im Schatten verbirgt und sein Gesicht nicht zeigt“. In diesem Moment war etwas sehr Zerbrechliches zerbrochen: das Vertrauen und die Liebe zu meinem Vater. Erst später sollte ich dies erfahren, als andere ihr Vertrauen und ihre Liebe zu mir verloren hatten und ich mich selbst auf dem Weg der Trunkenheit verlor, auf dem auch er sich verloren hatte.
Der Bus kündigte sich zum ersten Mal um fünf Uhr an: Der Nachbar, der Wasser in den Kühler gefüllt hatte, schlug in der Stille des frühen Morgens immer die Motorhaube zu. Dies geschah, während wir uns anzogen. Oder halb noch in unseren Träumen, in denen wir rennen mussten. Wir fuhren mit dem Bus früher los als alle anderen Kinder. In den ersten Monaten des Jahres waren die Straßen noch dunkel, aber schon im Mai knallte uns die Sonne ins Gesicht. Ich verwende den Plural, weil ich in der Gesellschaft anderer Kinder war, zwei Freunden aus der Kindheit. El Negro, der in derselben Schule war wie ich, und El Puya, der auf eine andere Schule ging. Wir passierten vor sechs Uhr unsere Schule, fuhren von einem Ende zum anderen durch die Stadt, und erst eine Stunde später, als El Puya schon ausgestiegen war und wir auf dem Rückweg waren, stiegen El Negro und ich aus, kurz bevor die Schule ihre Türen öffnete.
Eines Morgens nahm der Nachbar meine Mutter zur Seite. Er erklärte ihr, dass sich eine von den Fahrgästen darüber beschwert hatte, dass das Fahrzeug als Schulbus benutzt wurde, und er mich deshalb auf dem Weg absetzen müsse, damit die Frau mich nicht sah. Meine Freunde waren davon nicht betroffen: El Negro war der Sohn des Nachbarn, und El Puya stieg aus, kurz bevor die Frau einstieg. Mir schien das ungerecht. Dass mich jemand, der mich nicht mal kannte, zwang auszusteigen ... Etwas Ähnliches geschah mit einer Figur in „Tajimara“. Aus einer Laune heraus nahm Cecilia ihn mit im Bus ihrer Gefühle und setzte ihn wieder ab:
Die endlosen Nachmittage, an denen ich versuchte, ihr Genuss zu bereiten, und der Geruch unserer Körper nach stundenlangen Gesprächen im Bett, mit ineinander verschlungenen Beinen, die Laken mit Asche bestäubt. „Manchmal fühle ich gar nichts. Es hat keinen Sinn. Es ist immer das Gleiche. Ich bin krank.“ Immer mit wem? Aber dann, wenn sie schwitzte, schlang sie ihre Beine um meine Taille, und ich suchte sie von innen, und nachdem sie sich hin und her gewälzt und gestöhnt und geseufzt hatte, entspannte sie sich endlich und murmelte: „Danke, danke, dass du auf mich gewartet hast.“ (...) Dann verbrachte sie den ganzen Tag mit mir. Ich wurde nicht müde, sie anzusehen. „Du, du.“ „Nein, die bin ich nicht mehr. Träume nicht, erfinde nicht. Es ist alles vorbei.“
Cecilia liebte nur sich selbst, aber er bemerkte es nicht. Oder vielleicht doch. Liebe und Selbsttäuschung fahren im selben Bus, sie sind gezwungenermaßen Sitznachbarn. Nicht umsonst sagt der Erzähler: „Wir setzen alles aus unserer Vorstellungskraft zusammen und sind unfähig, einfach nur die Wirklichkeit zu leben“.
Den Nachbarn habe ich als einen ehrlichen Mann mit eisernen moralischen Prinzipien in Erinnerung. Er war äußerst streng und zurückhaltend, ganz anders als die feierfreudige Nachbarschaft im Viertel. Er hätte mich auch durchaus nicht mitnehmen können, aber aus irgendeinem Grund entschied er sich, nachsichtig zu sein. Vielleicht sah er in mir etwas von seinem Sohn, vielleicht suchte ihn aber auch ein Geist der Vergangenheit heim: der, der vor Jahren vorgeschlagen hatte, Unterschriften zu sammeln für unseren Auszug aus dem Viertel, nachdem meine Mutter sich von meinem Vater getrennt und mit einem anderen Mann zusammengezogen war.
Tatsache ist, dass von diesem Tag an das Warten begann. Von jener Dämmerstunde an, als der Bus mich vor der Schule absetzte. Von jener Stunde an, als ich auf einer Brüstung saß und die Minuten zählte, bis der Aufseher das Tor öffnete. Das Warten und die Einsamkeit in dieser Straße, in der niemand vorbeikam oder nur wenige noch Schlaftrunkene. Menschen, die kaum grüßten und nicht den geringsten Raum für ein Gespräch ließen. Damals hätte ich gerne „Tajimara“ gelesen, Cecilia, die Frau aus der Geschichte, kennengelernt. Kapriziös wie keine andere, zum Umfallen lächerlich, „zerbrechlich, absurd, schüchtern und schamlos ... so schwer zu durchschauen und so unausgeglichen, und manchmal auch dermaßen dämlich“. Dieselbe, die mich aus dem Bus geworfen hat, das weiß ich jetzt, hat mich durch eine seltsame Zeitschleife in meine Realität jener Jahre zurückversetzt. Nur so kann ich verstehen, wie sie war, wer sie war und was sie gegen mich hatte. Denn ihren Namen habe ich nie erfahren und ihr Gesicht habe ich vergessen. Vielleicht habe ich sie auch nie gesehen, so vertieft war ich in das, was sich mir draußen bot: das morgendliche Chaos der ersten Stadt, in der ich lebte, und wenig später ihr Geschenk der Einsamkeit: das Warten vor der noch geschlossenen Schule und jenes Gefühl der Trostlosigkeit, das dem Verlust einer Liebe so ähnlich ist.



