Nichts und niemanden lieben können
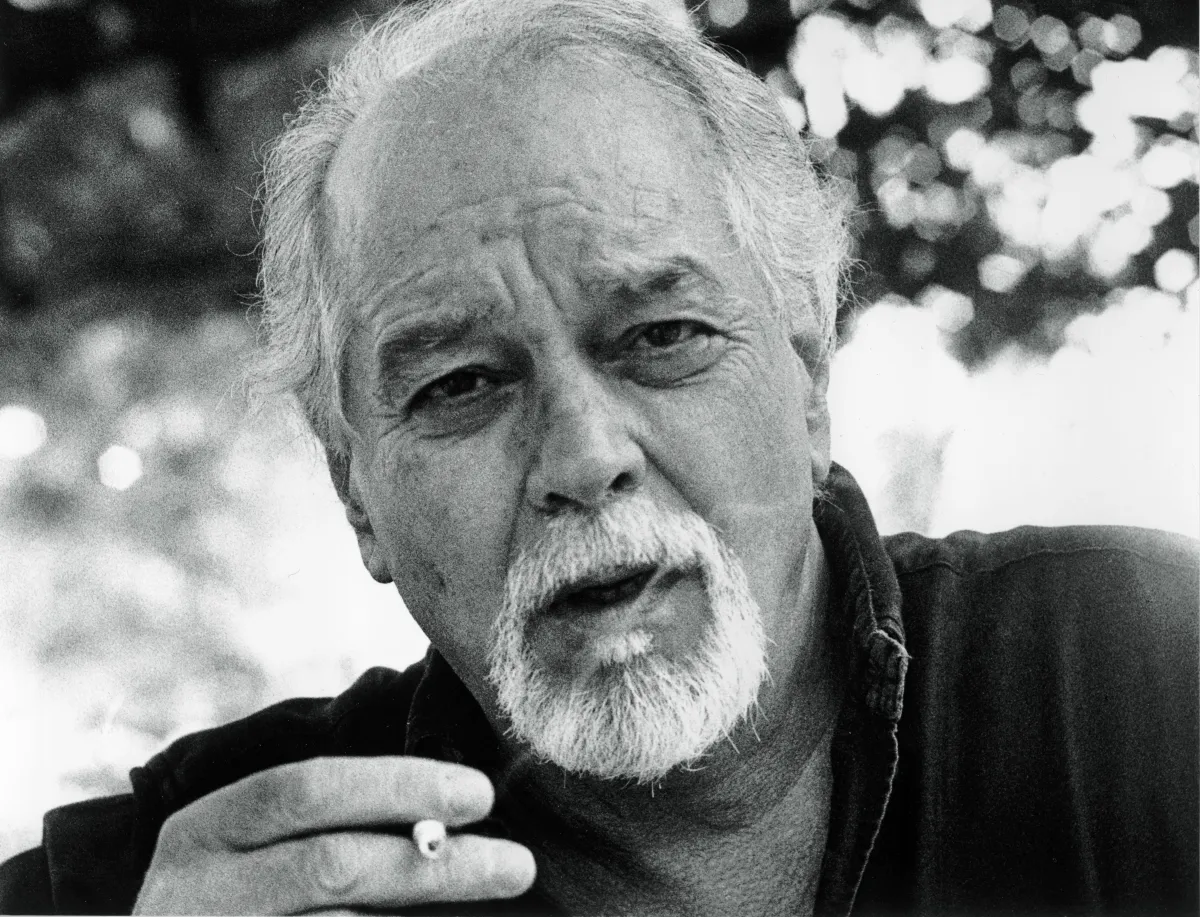
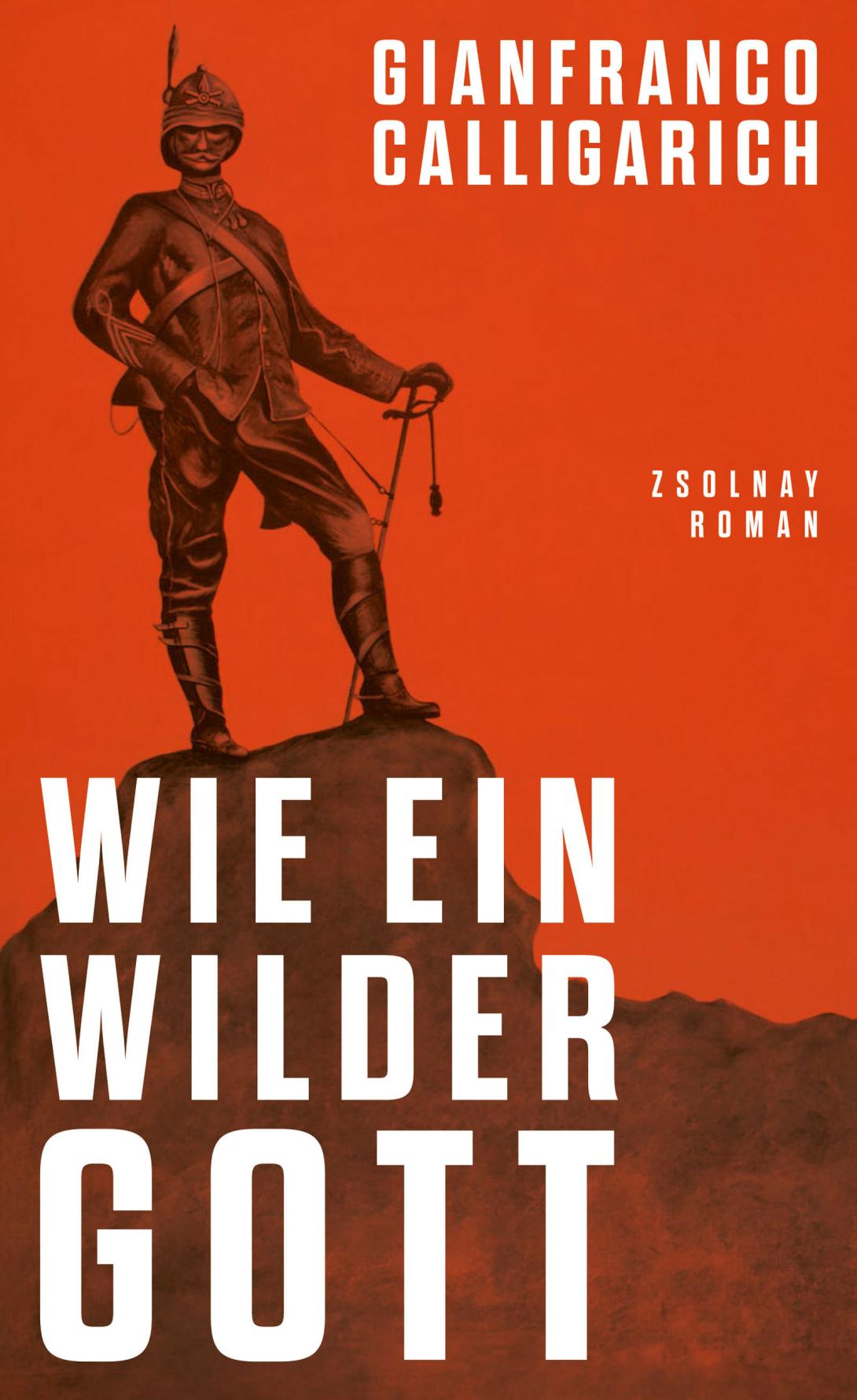 Zsolnay
ZsolnayGianfranco Calligarich | Wie ein wilder Gott | Zsolnay | 208 Seiten | 24 EUR
Wer an den 1947 geborenen Gianfranco Calligarich denkt, dürfte zuerst an Calligarichs erstaunliche literarische Wiederentdeckung im Jahr 2022 denken, als sein 1973 erschienener Debüt-Roman Der letzte Sommer in der Stadt wiederveröffentlicht und zu einem großen Erfolg wurde. Ein Rom-Roman und alles andere als eine Rom-Com, sondern ein melancholischer Abgesang auf die Jugend und die Träume, der an den jungen Marcello Mastroianni in Fellinis La Dolce Vita erinnerte und der so lakonisch und ironisch geschrieben war, dass es sich auch 50 Jahre später noch so frisch wie damals liest.
Mit diesem postmodernen Impetus ist auch Calligarichs neuer Roman geschrieben. Dieses Mal erzählt er allerdings nicht von seinem Leben, obwohl ein wenig Calligarich auch in diesem Roman steckt, denn Calligarich stammt zwar aus einer Triestiner Familie, wurde aber 1947 in Asmara in Eritrea geboren, um dann in Mailand aufzuwachsen. Die koloniale Verstrickung seiner Familie hat Calligarisch bereits 2017 in seinem mit dem Viareggio-Preis ausgezichneten La malinconia dei Crusich aufgearbeitet; in Wie ein wilder Gott begibt er sich nun an die früheren kolonialen Verstrickungen Italiens im heutigen Äthiopien und Eritrea, in denen gewissermaßen die Grundlagen für Familien wie die der Calligarichs geschaffen wurden, um ihre Heimat verlassen zu können.
Calligarich erzählt von einem jener Abenteurer, wie es sie im 19. Jahrhundert zu Haufe gab, und von denen David Livingstone und Henry Morton Stanley nur die Speerspitze einer kleinen Armada bildeten, deren Lebenslinien bis zum Ende der kolonialen Zeiten als Heldengeschichten in allen nur denkbaren Formaten existierten. Heute werden diese Geschichten neu kontextualisiert, etwa in Petina Gappahs fesselndem Out of Darkness, Shining Light, in dem nicht mehr die Geschichte von David Livingstone, sondern die seiner Träger erzählt wird. Oder, um auf den äthiopischen Kulturraum zurückzukehren, um einen indigenen Blickwinkel ergänzt, wie in Maaza Mengistes düsterem The Shadow King. Oder es wird gleich alles belletristische Beiwerk sein gelassen und die Geschichte journalistisch gnadenlos und akkurat seziert, wie in Michela Wrong’s großartiger Studie I Didn’t Do It for You: How the World Betrayed a Small African Nation.
Diesem Wandel ist sich natürlich auch Calligarich in seiner profund recherchierten Geschichte über Vittorio Bottego bewusst, in dem allein die Stimme des Erzählers erfunden ist. Der Unmöglichkeit, ein dichtes Heldenepos Bottegos zu erzählen, der allein durch eine erfolgreiche Forschungsreise den Juba-Fluss hinab und eine gescheiterte Expedition am Omo-Fluss, bei dem er auch sein Leben verlor, seinen Wikipedia-Eintrag rechtfertigt, begegnet Calligarch mit gleich mehreren Strategien.
Inhaltlich konzentriert er sich auf die grundsätzlich zerfahrene italienische Politik des ausgehenden 19. Jahrhunderts, die zwischen kolonialem Größenwahn und einer beißenden Kritik am kolonialen Programm überraschend vielfältig war und einen Offizier der italienischen Armee wie Bottego immer wieder zur Verzweiflung brachte, weil lang gehegte Pläne durchkreuzt und spontane Alternativen gesucht werden mussten. So zerfahren und postmodern schildert Calligarich dann auch seinen Antihelden, der konsequent nach dem Credo später Popkulturgrößen zu handeln scheint und gemäß dem späten Punk-Credo „It’s better to burn out than to fade away“ so rastlos wie zum Teil sinnlos unerforschte Flüsse erforscht. Das hat nicht nur wegen der so grotesk wie grausamen Erschießungen von Trägern - aus Angst, dass sie desertieren könnten - nichts von einer Heldengeschichte, sondern ist sogar im Planungsstadium oft derartig stümperhaft, dass der Leser überrascht ist, dass Bottego nicht schon auf seiner ersten Expedition ums Leben gekommen ist. Und auch das Bottego "seinen" Fluss als "wilden Gott" sieht und Calligarichs Roman seinen Titel gibt, macht es nicht besser, denn letztendlich versteht sich ja bis heute der Bezwinger eines solchen Flusses, Berges, Wüste oder Meeres als nur noch wilderer, neuer Gott.
Neben diesen inhaltlichen Brüchen, die jede Heldengeschichte von vorneherein ausschließt, verweigert Calligarich seinem Helden allerdings auch die Sprache. Wie bei seinem jungen römischen Helden in Der letzte Sommer in der Stadt sind es auch hier Lakonie und Ironie, die den Lesefluss immer wieder massiv aufbrechen und die Irritation erzeugen, die wir natürlich selbst mit unseren eigenen „kolonialen“ Erwartungshaltungen, an eine auch in ihrer Grausamkeit „prall“ auserzählte Geschichte haben. Das lässt Calligarich nicht zu. Stattdessen deutet er an, streut Köder, um dann lakonisch abzubrechen, etwa wenn es um die vielen wichtigen halben Stunden in dem Roman geht: „Die halben Stunden. Aber so war es. Und immer soweit. So weit die Dinge zwischen den beiden in San Lazzaro. Delia Montenero. Nichts und niemanden würde er lieben können außer seinem Entdeckerleben.“ Das macht Sinn und ist klug konzipiert, doch wer ein identifikatorischer Leser ist, dürfte enttäuscht sein, weil ihm stets genommen wird, was ihm eben noch versprochen war.
Als Roman funktioniert das dennoch, auch weil Calligarich damit ein Chronist seiner Zeit ist, der nicht nur von den Verwerfungen der menschlichen Seele und Politik der Vergangenheit berichtet, sondern auch von den neokolonialen Sehnsüchten unserer Gegenwart. Denn ein Scheiternder wie Bottego gleicht dann doch verblüffend den erfolgreichen, neoliberalen Helden transnationaler Unternehmungen unserer Gegenwart, die in ihrem Expansionsdrang und den dementsprechenden Strategien den Kolonialregierungen des 18. und 19. Jahrhunderts in kaum etwas nachstehen.



