Lebenswerte Langeweile

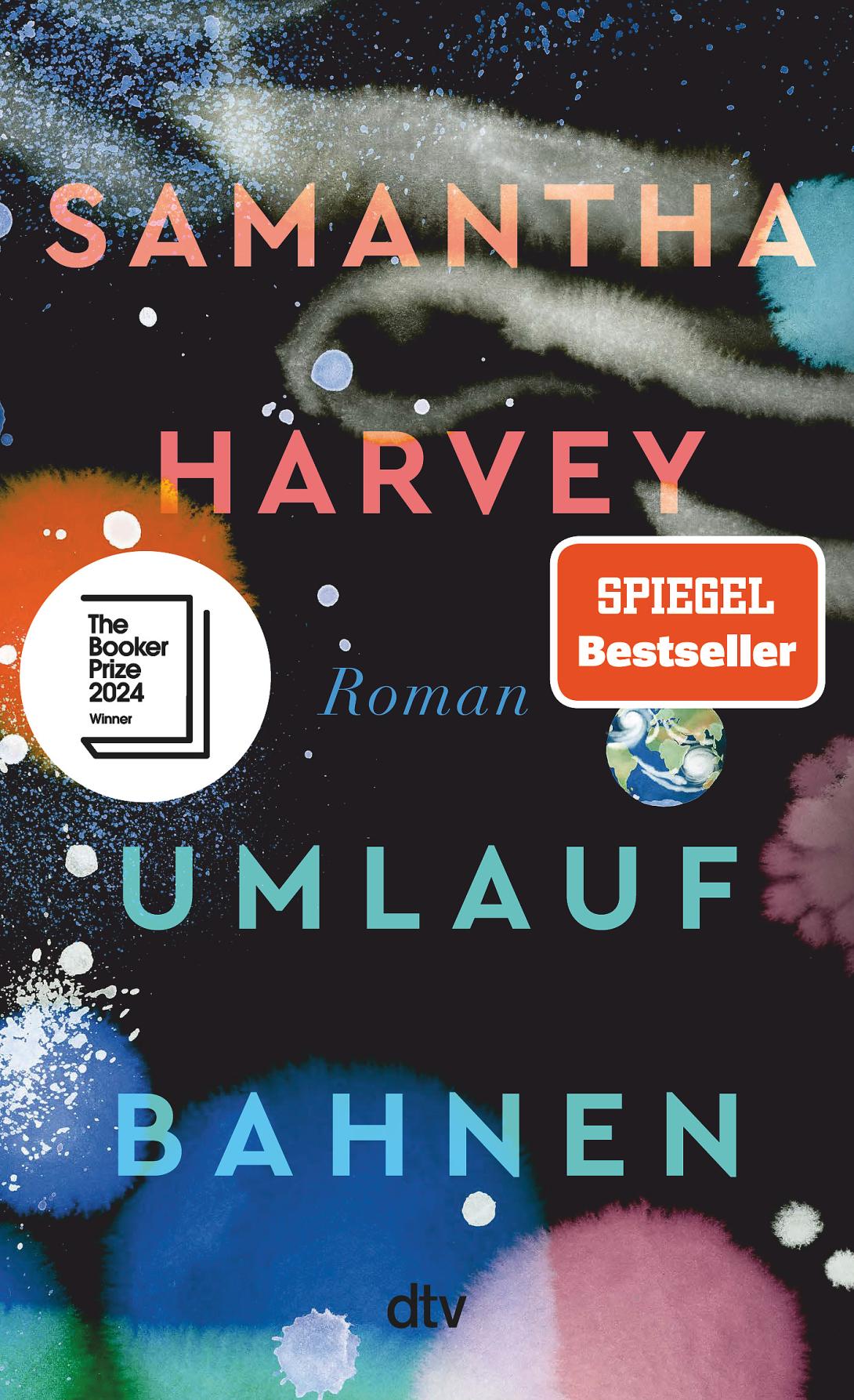 dtv
dtvSamantha Harvey | Umlaufbahnen | dtv | 224 Seiten | 22 EUR
Manchmal muss man sich entfernen, um besser zu sehen. Das haben Generationen von Ethnologen genauso wie Filmemacher und natürlich Schriftsteller erfahren und es gilt auch für Samantha Harveys 2024 mit dem Booker-Preis ausgezeichneten und im englischen Original gerade mal 144 Seiten kurzen Roman, der sich einer Gruppe von Astronauten annimmt, die auf einer Raumstation um die Erde kreisen während ein Raumschiff kurz davor ist, auf dem Mond zu landen. Wir befinden uns also nicht in unserer unmittelbaren Gegenwart, aber auch nicht in einer dystopischen Zukunft, wie in Gabriela Cowperthwaites Science Fiction-Thriller I.S.S., der so wie Harvey Roman ebenfalls im Jahr 2023 erschienen ist und in dem die Mannschaft einer vergleichbaren Raumstation zusehen muss, wie die Erde in einer atomaren Kriegseskalation verglüht und sich das, was auf der Erde ereignet, auch auf der Station anbahnt.
Bei Harvey ist alles anders. Auch hier sieht die internationale Besatzung eine bedrohte Erde, doch es scheint noch alles im Lot. Der mögliche Schrecken entsteht viel mehr aus den kontemplativen Betrachtungen der Besatzung, die sich assoziativ mit jeder neuen Umflaufbahn und der Betrachtung auf Unwetter, Städte und Kontinente ergibt. Das hat immer wieder philosophischen Charakter, wenn sich etwa die Besatzung durch die Distanz zu Aliens transformiert fühlt, die bei ihrer absehbaren Rückkehr auf die Erde eine verrückt gewordene Welt verstehen lernen müssen. Derartig ernüchternde Gedanken werden jedoch stets durch lyrische Passagen gebrochen – Sätze, die eine Erde beschreiben, die aus dem All wie ein Himmel aussieht, ein Himmel, der in Farben zerfließt und dessen Farben in ihrer Sprengkraft allein schon genug Hoffnung verbreiten, um weiter leben zu wollen.
So wie bei Stanslaw Lem und seinen legendären Erzählungen über den Commander Pirx sind auch Samantha Harveys Astronauten einsame Menschen, die in einem kalten und einsamen Weltall treiben, ohne jede Vision und Hoffnung auf andere Welten und Wesen.
„Und so schaut die Menschheit in Einsamkeit und Neugier und Hoffnung nach draußen und denkt, dass sie vielleicht auf dem Mars sind, die anderen, und sendet Sonden aus. Aber der Mars scheint eine gefrorene Wüste aus Rissen und Kratern zu sein, also sind sie vielleicht im benachbarten Sonnensystem, oder in der benachbarten Galaxie, oder in der Galaxie danach.“
Die einzige Hoffnung ist – nicht anders als bei Lem – der Mensch selbst und bei Harvey im Besonderen die Erde selbst, die bei Lem schon längst in Vergessenheit geraten ist; eine Heimatlosigkeit, die Lem dazu animiert, aus den Begegnungen mit dem Nichts umso pointiertere Erzählungen über die Menschen und ihrer Verfehlungen zu formen und so etwas wie eine menschliche Daseinsberechtigung zu erwirken.
Das würde auch erklären, warum sich Harvey einem normalen Narrativ verschließt, man immer wieder meint, es mit einem groß angelegten „Langgedicht“ zu tun zu haben, mit einer Poesie, die bei allem sinnenden und beobachtenden stets auch etwas mahnendes hat. Denn wenn wir schon allein sind, ist es um so wichtiger, das zu bewahren, dass uns als Spezies Schutz bietet, die Erde. Diese Gedanken sind nicht neu, sie erinnern an die Hippie-Sehnsüchte der späten 1960er und frühen 1970er Jahren nach einer anderen und besseren Welt, die ihren Ausdruck in ganzheitlichen Ideen wie der Gaia-Hypothese fanden.
Auch Harveys Astronauten erkennen in ihren Betrachtungen das organische, allumfassende im Blick auf die Erde, ein Blick und eine Mutmaßung, die angesichts des destruktiven Populismus unserer Gegenwart natürlich umso wichtiger zu erkennen ist. Im kontemplativen Lesen von Harveys Prosa machen dann plötzlich auch Gedankenspiele einen Sinn, in dem jeder Politiker für ein paar Tage auf die I.S.S. geschickt werden könnte, um zu erkennen, was man vielleicht nur aus der Ferne erkennen kann.
Man könnte diesem stillen, suchenden Buch dennoch ankreiden, dass es sich die Dinge ein wenig zu leicht macht. Zwar gibt es für jeden der Besatzung ein paar Besonderheiten, ist es bei Chie etwa die defizitäre Beziehung zur gerade verstorbenen Mutter, die thematisiert wird, entstehen ernüchternde Klarheiten in einer Liebesbeziehung oder gibt es ein zufälliges Funk-Intermezzo mit einer Frau auf der Erde, deren Mann gerade verstorben ist und die mit ihrem Funkgerät auf gut Glück Kontakt mit einem der Astronauten hat aufnehmen können. Doch sind im Kern all diese Charaktere austauschbar, wird keiner der an Bord der Station befindlichen Personen zu wirklichem Leben erweckt, flotieren ihre Gedanken von einem zum anderen, um zu so etwas wie einem kollektiven Unbewussten zu verschmelzen. Mit den dann oft ebenfalls seitenlangen, genauso kollektiv flotierenden, nicht enden wollenden Beschreibungen von umflogenen, geostrategischen Besonderheiten kann beim Leser deshalb eine fast schon Mantra-artige Sehnsucht nach Erlösung aufkommen.
Aber auch dafür sorgt Harvey am Ende, denn sie macht auf ihre zurückhaltende Art dann doch auch ansatzweise ernüchternd deutlich, dass auf die Vergangenheit die Zukunft und dann wieder die Vergangenheit und erneut die Zukunft kommt – das Jetzt also so ewig ist, wie es niemals gegenwärtig sein kann. Dass die Geschichte seit dem Big-Bang eine der Langeweile ohne Ende ist, heißt jedoch noch lange nicht, dass es keine lebenswerte Langeweile ist. Vor allem wenn das, mit und auf dem wir leben so schön ist, dass wir es ständig vergessen müssen:
„Und jetzt ziehen die Städte am Golf von Oman vorbei, vom Morgengrauen geblendet. Rosafarbene Berge, lavendelfarbene Wüste, und vor uns Afghanistan, Usbekistan, Kasachstan und eine ahnungsvolle Rundung schwacher Wolken, die der Mond ist.“



