Hartes Land, blindes Herz

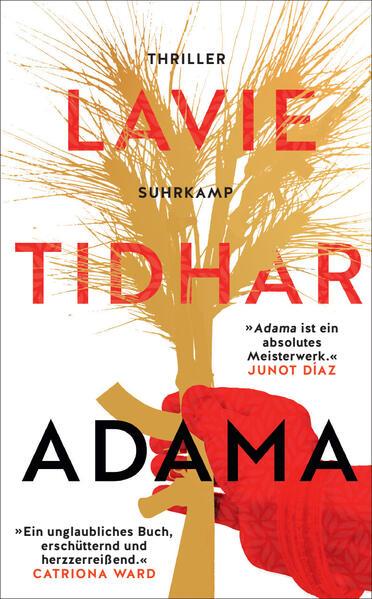 Suhrkamp
SuhrkampLavie Tidhar | Adama | Suhrkamp | 425 Seiten | 22 EUR
Es wirkt wie eine bittere Ironie des Literaturbetriebs, dass ausgerechnet jetzt, da die israelische Gesellschaft sich im Innersten zerreibt, hebräische Literatur im deutschsprachigen Raum verstummt. Während in Feuilletons diskutiert wird, ob deutsche Belletristik-Verlage sich bei aller Abwehr nicht doch faktisch an einem kulturellen Boykott beteiligen, indem sie schlicht kaum noch übersetzen, erscheint Adama von Lavie Tidhar wie ein trotziges Gegenstück: ein Roman, der sich weigert, weichgezeichnet zu werden, der Israel nicht als fatale Abstraktion, sondern als geerdete, schmerzhafte, blutende Realität erzählt. Und Tidhar kann es sich leisten. Denn er schreibt nicht auf Hebräisch, sondern auf Englisch, seit Jahren preisgekrönt, international etabliert, einer der wenigen israelischen Autoren, dessen Stimme die aktuelle Übersetzungsdelle unbeschadet übersteht.
Vielleicht liegt in dieser Distanz die überraschende Wucht dieses Romans. Denn Adama ist kein Diaspora-Blick, kein politischer Essay mit erzählerischem Beiwerk, sondern eine Art Familien-Belagerungszustand, ein Thriller im Untergrund der Geschichte und zugleich die Chronik eines Verfalls: der Idee des Kibbuz, und mit ihr vielleicht der Idee eines anderen, besseren Israel. Tidhar nimmt seine eigene Familiengeschichte, die seiner Mutter, die als Displaced Person aus Deutschland nach Palästina kam, und baut daraus einen prismatischen Roman, der sich wie eine Mischung aus Batja Gurs Kriminalromanen (die ebenfalls isolierte Soziotope mit eigenen Regeln wie Psychoanalytiker, Literaturwissenschaftler oder Mitglieder eines Kibbuz sezierte), der israelischen Fernsehserie Fauda und Peter Buwaldas Bonita Avenue liest – nur böser, greller, kompromissloser.
Schon der Einstieg zeigt, was Tidhars Prosa kann. Esther, eine der Frauenfiguren des Buches, steht „vom kleinen Schlafzimmerfenster eingerahmt“, ein trüber Heiligenschein um ihr erschöpftes Gesicht, und bittet um einen Tee „mit einer Scheibe Zitrone, wie in der Heimat“. Die Antwort kommt hart: „Unsere Heimat ist hier.“ Es ist dieser permanente Ruck, dieses Auseinanderscheren zwischen Sehnsucht und Dogma, der Adama durchzieht. Niemand darf schwach sein, niemand nostalgisch, niemand sentimental. Und doch sind sie es alle.
Im Mittelpunkt steht Ruth, Tidhars zentrale Figur, eine ungarisch-jüdische Zionistin, die 1946 nach Palästina gelangt und den Kibbuz Trashim wie eine Kommandantin der Utopie errichtet. Für Ruth ist der Kibbuz „heilige Erde“, Adama, ihre Lebensaufgabe, wenn nötig zu verteidigen „inklusive Gewalt und Mord“. Die Härte, mit der sie agiert, erscheint zunächst als Stärke; später wird sie zum Gift. Und genau darin liegt eine der stärksten Leistungen des Romans: Tidhar zeigt, wie ein Ideal, das Menschen schützt, dieselben Menschen zerstören kann.
Die Gewaltgeschichte Israels ist nicht nur Kulisse, sondern innerer Motor der Erzählung. Der Roman spannt sich von 1945 bis 2009, durch britische Mandatstruppen, die Nakba, mehrere Kriege, gesellschaftliche Umbrüche. Aber das Politische bleibt nie abstrakt, sondern greift in Körper und Leben der Figuren ein. In einer der stärksten Passagen denkt Ruth beim Arbeiten in der Hitze: „All das mussten sie tun… damit ihre Kinder eines Tages über grünes Gras gehen würden, in einem Land, das ihnen gehörte und niemandem sonst.“ Die Utopie wird hier weder romantisiert noch denunziert. Sie wird als Mühsal gezeigt, als körperliche Arbeit, als Kampf gegen Gestein, Staub, Trockenheit – und als allmählicher moralischer Blindflug.
Die jüngeren Generationen sehen den Kibbuz inzwischen als Fehler, als Sackgasse. Eine andere Stimme blickt auf die Gegenwart und denkt: „So war es auch mit den Kibbuzim und dem Staat… Sozialistische Wespen in einem kapitalistischen Körper: Aber jetzt krankten beide.“ Dieses Bild – ein Staat, der seinen einstigen Gründungsmythos wie ein nutzloses Organ mit sich herumträgt – ist so prägnant und treffend, dass man es nachklingen hört wie ein Rauschen.
Adama funktioniert zugleich als Kriminalroman: Menschen verschwinden, alte Rechnungen tauchen wieder auf, und die moralische Ambivalenz, die den Aufbau des Kibbuz begleitet, kehrt später als Verhängnis zurück. Die Struktur erinnert wie schon angedeutet an Batja Gur, doch Tidhars Ton ist rauer, weniger ironisch, weniger analytisch – mehr Fauda als Feuilleton. Eine Figur könnte tatsächlich direkt von Lior Raz gespielt werden: voller Zorn, voller Müdigkeit, immer auf der Grenze zwischen Pflicht und Explosion. Und das Familiengeflecht, das Tidhar zeichnet, steht in seiner Unübersichtlichkeit, seiner Brutalität, seiner Komik und Unbarmherzigkeit ganz in der Tradition Peter Buwaldas.
Dabei bleibt der Roman nicht bei den Opfer-Tätern der Gründergeneration stehen. Shosh, eine Holocaust-Überlebende, wird von den „Tzabarim“, den in Israel Geborenen, gleichermaßen „als Opfer wie als Verdächtige“ gesehen. Und der Satz ihres Lehrers – „Es gibt kein A-d-a-m-a ohne d-a-m… kein Land ohne Blut“ – zieht sich wie ein dunkler Leitfaden durch das Buch. Shosh „hatte Blut satt“ – auch das ein Satz, der einem nachgeht wie eine Wunde.
Die emotionale Wucht liegt jedoch vor allem im Zerfall des Kibbuz selbst. Die Sitzungen eskalieren, die Jüngeren wollen ihre Kinder nicht mehr in Gemeinschaftshäuser geben, „man merkte es noch nicht, aber der Kibbuz starb“. Ruth kämpft dagegen wie gegen ein Naturgesetz. Doch die Zeit frisst ihre Ideale, die Revolution ihre Kinder, und als ihr Sohn Ophek sie tröstet – „Mich hast du ja noch“ – denkt er nur an Flucht. Diese Spannung zwischen Bindung und Entkommenwollen ist eine der präzisesten Beschreibungen israelischer Familienrealität, die man seit Amos Oz gelesen hat.
Denn natürlich steht Adama im Schatten des großen israelischen Überromans Eine Geschichte von Liebe und Finsternis, einem meiner Lieblingsbücher seit Jahren, versucht es doch erzählerisch nicht nur die Risse, die Israel durchzieht, zu erklären, sondern auch zu heilen. Tidhar erreicht diese epische, kathartische Totalität nicht – aber er will es auch nicht. Was er erzählt, ist der langsame Verrat an einer Idee. Die Kibbuz-Utopie wird Korruption, Folklore, Ballast. Und in dieser Erzählung liegt eine erstaunliche Kraft. Das Private ist nie getrennt vom Politischen, das Politische nie getrennt vom Körper, der Körper nie getrennt vom Land.
Adama ist ein Roman über die Unmöglichkeit, unschuldig zu bleiben. Ein Roman über Familien, die einander zerstören, weil sie sich lieben. Ein Roman über ein Land, das mit jeder Generation neu erfunden und neu verfehlt wird. Ein Roman über die Sturheit der Geschichte und die Zärtlichkeit, die ausgerechnet dort aufblitzt, wo alles verloren scheint.
Und es ist – in seiner Härte, seiner Zärtlichkeit, seiner historischen Genauigkeit – einer der ambivalentesten, aufregendsten Israel-Romane der letzten Jahre. Tidhar erzählt nicht den großen Mythos wie Amos Oz, sondern den kleineren, schmutzigeren, intimeren. Aber gerade darin liegt die Stärke dieses Buches.
Hat Ihnen dieser Text gefallen? Dann unterstützen Sie doch bitte unsere Arbeit einmalig oder monatlich über eins unserer Abonnements. Wir würden uns freuen!
Wollen Sie keinen Text mehr auf Literatur.Review verpassen? Dann melden Sie sich kostenlos für unseren Newsletter an!



