Durch Paradigmen sehen, hell und klar

Peter Baranowski wurde in Frankfurt am Main geboren und studierte Physik und Arabisch in Heidelberg, Berlin und Oxford, bevor er das Regiestudium an der Hochschule für Fernsehen und Film München absolvierte.
Nach kurzer Tätigkeit in der Privatwirtschaft führte er bei preisgekrönten Kurzfilmen wie Rauschgift (Locarno-Gewinner) und Bis ich es weiß (Toronto) Regie. Sein Dokumentarfilm Die Temperatur des Willens wurde in München uraufgeführt und kam in die deutschen Kinos.
Für seinen Spielfilm Science lebte er in Zentralasien und entwickelt nun mit seiner Münchner Firma Rohstoff Film Projekte an der Schnittstelle von Wissenschaft und Kunst.
Hätte es ChatGPT schon bei meiner Berufswahl gegeben, hätte ich mich wahrscheinlich sofort angemeldet. Zu viele Wege schienen einfach reichhaltig und vielversprechend und ich sehnte mich danach, die Entscheidung zu delegieren. Meine Bereitschaft, mich in ein Gebiet zu vertiefen, war groß, aber auch meine Unsicherheit, welches Gebiet es denn sein sollte. Könnte das Dilemma dadurch gelöst werden, dass man etwas wählt, das weitgefächert genug ist, um mehrere Welten gleichzeitig zu bewohnen? Aber was genau könnte das sein?
Rückblickend versuche ich zu verstehen, warum ich mich schließlich für Physik entschieden habe. Ich vermute, dass eine der Auslegungen von Stephen Hawkings Behauptung - dass die Philosophie der Physik gewichen sei - eine Rolle gespielt hat. Im Einklang mit dem Zeitgeist und angeheizt durch die Science-Fiction-Popkultur muss ich wohl geglaubt haben, dass Raumschiffe und Teleskope uns den Sternen näher bringen könnten, als es, sagen wir, Dantes Darstellung des Paradieses je hätte können.
An der Universität begann ich jedoch zu spüren, dass mit der modernen Physik etwas nicht stimmte. Ihr Zugang zur Realität war reichhaltig, extravagant und manchmal subversiv. Doch nichts davon schien sich auf die menschliche Erfahrung übertragen zu lassen. Heute würde ich vielleicht mit den Schultern zucken - denn das tun ja viele Disziplinen nicht. Aber damals war ich auf der Suche nach mehr.
Eine angesehene Theorie in der Physik behauptet, dass sich das Universum in unendlich viele Nachkommen-Universen aufspaltet, wenn ein Laserstrahl durch ein winziges Loch fällt. Wahr, tiefgründig, poetisch? Vielleicht. Doch im Prinzip haben wir keinen Zugang zu irgendeinem dieser Universen außer zu dem, in dem wir leben. Solche Ausschlüsse überschatten die meisten Darstellungen der Physiker über die wilden Seiten der Realität: All die Magie geschieht "nur auf der Quantenebene", "bei annähernder Lichtgeschwindigkeit" oder sogar "vor Raum und Zeit". Was mich frustrierte, war, dass diese Ideen von der gelebten Erfahrung absichtlich abgeschottet blieben.
"Wir sehen jetzt durch ein dunkles Glas", lautet eine Zeile aus einer viel älteren Quelle der Weisheit, die den schwierigen Zugang der Menschheit zur Wahrheit anerkennt. Der heilige Paulus versprach den Korinthern: "Aber dann werden wir von Angesicht zu Angesicht sehen", was auf das Leben nach dem Tod hindeutet. Im Gegensatz dazu hat das wissenschaftliche Projekt lange versucht, dieses "dann" fest in der Welt der Lebenden zu verankern. Doch trotz seiner Erfolge - von der Entstehung der Wissenschaft im sechzehnten und siebzehnten Jahrhundert bis heute - ist das Problem des Zugangs nie verschwunden. Vielleicht liegt genau hier, in der Lücke, das wahre Geheimnis.
Die Physik sieht die Welt durch die Mathematik. Um einen klaren Blick darauf zu werfen, müssen die Studenten ihre geistigen Ressourcen bis an die Grenze ausreizen - und darüber hinaus. Niemand, den ich zwischen Heidelberg und Harvard getroffen habe, hat die notwendige Neuverdrahtung unangefochten vorgenommen; viele Überlebende sind tief gezeichnet daraus hervorgegangen. Denn wenn man die Mathematik nicht beherrscht, kann man nicht darauf hoffen, in den Stamm der Eingeweihten aufgenommen zu werden. In einem solchen Kontext könnte sich die Hinwendung zur Wissenschaftsgeschichte anfühlen, als würde man vor knallharten Differentialgleichungen fliehen, um es sich unter den Fehlern der Vergangenheit bequem zu machen. Doch gerade in der Grauzone zwischen Geschichte und Philosophie erschütterte 1962 eine echte Bombe die wissenschaftliche Gemeinschaft - und brachte mich den Sternen ein Stück näher.
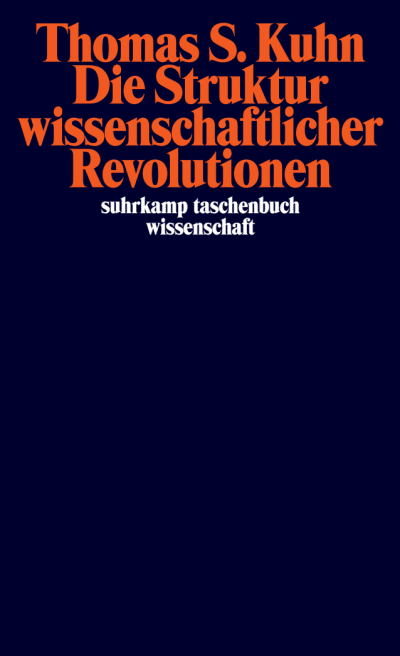 Suhrkamp
SuhrkampThomas S. Kuhn | Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen | Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft | 239 Seiten | 17 EUR
Thomas Kuhn, damals ein junger Harvard-Physiker, veröffentlichte The Structure of Scientific Revolutions und stellte damit alles in Frage, was man über die Funktionsweise der Wissenschaft glaubte. Während die meisten sich einen stetigen Wissenszuwachs vorstellten, zeigte Kuhn, dass der Fortschritt durch krasse, unumkehrbare Brüche zustande kommt.
Er verglich diese Brüche mit einem Gestaltwechsel - wie eine Zeichnung erst als Ente und dann als Kaninchen erscheinen kann, ohne dass sich die Linien verschieben. Sobald der Wechsel stattfindet, entgleitet die alte Figur dem Blick. Die Wissenschaftsgeschichte bietet viele derartiger Momente. Im Kosmos des Ptolemäus stand jahrhundertelang die Erde im Mittelpunkt, während Sonne und Mond als Planeten galten. Kopernikus zeichnete keine neuen Sterne, doch die Erde wurde zu einem Planeten, der die Sonne umkreist. Der Himmel hatte sich nicht verändert, aber die Welt schon. In ähnlicher Weise wurde das Feuer, das einst als aus der Materie entweichendes Phlogiston angesehen wurde, unter Lavoisier zu Sauerstoff, der sich mit der Materie verbindet. Flammen sahen gleich aus, brannten aber in einer neuen Realität.
Das ist für Kuhn das Wesen eines Paradigmenwechsels: keine langsame Anhäufung von Fakten, sondern eine plötzliche Neukonfiguration der Sichtweise, wenn die gleichen Beweise einer anderen Welt angehören. Damit sind alle Brücken abgebrochen: Ein Paradigmenwechsel bringt ein neues Wort, eine neue Sprache, sogar eine neue Bedeutung der Wissenschaft hervor. Leute vom Fach lernen entweder die neue Sprache oder verblassen als Experten. Kuhn hat gezeigt, dass es (vielleicht sogar im Prinzip) keine neutrale Sprache gibt, in der sich Paradigmen verständigen könnten. Die Beispiele waren zwar schon vor Kuhn bekannt, aber es ist das Ausmaß, in dem er die Implikationen vorantreibt, das sein Werk so revolutionär macht. Und sein zentraler Begriff des "Paradigmenwechsels" hat dann auch Eingang in die Alltagssprache gefunden.
Bei der Lektüre stellte sich mir eine drängende Frage: Warum war ich nicht schon früher auf das gestoßen, was oft als einer der wichtigsten Beiträge des 20. Jahrhunderts zum Verständnis der Wissenschaft bezeichnet wird?
Ich stelle mir gerne vor, dass die Antwort faszinierender ist als der bloße versehentliche Zufall. Was wäre, wenn die Wissenschaft selbst sich gegen mich verschworen und mir verheimlicht hätte, wie Paradigmenwechsel ihre Grundlagen erschüttern? Wie Kuhn beschreibt, werden Studenten sorgfältig in die herrschenden Paradigmen eingeweiht, bis sie diese als unhinterfragte "Normalität" des wissenschaftlichen Arbeitens übernehmen. Die tägliche Arbeit erscheint dann weniger wie eine große Entdeckung, sondern eher wie das Lösen eines Puzzles - das Zusammenfügen von Teilen nach den Regeln des Paradigmas. Ganze Generationen können ihre Karrieren innerhalb dessen verbringen, was Kuhn unverblümt als "normale Wissenschaft" bezeichnet.
Während jedoch viele davon ausgehen, dass dieses Bild die Natur selbst repräsentiert, besteht Kuhn darauf, dass dies nur innerhalb der Grenzen des Paradigmas der Fall ist. Mit der Zeit zeigen sich Risse: Es häufen sich Phänomene, die sich einer Erklärung mit den verfügbaren Werkzeugen widersetzen. Das Paradigma gerät in eine Krise, bis ein neuer Rahmen geschmiedet wird. Solche Revolutionen gehen selten von etablierten Koryphäen ihres Fachs aus; häufiger kommen sie von Neulingen, die noch nichts in die "Art und Weise, wie die Dinge gemacht werden", investiert haben. Die Umstellung verläuft uneinheitlich: Die alte Garde wehrt sich, und ein neues Paradigma setzt sich oft erst durch, wenn seine Vorgänger bereits überholt sind. In der nächsten Generation ist die neue Ordnung so weit verinnerlicht, dass ihr provisorischer Charakter verschwindet.
Für die meisten Wissenschaftler kommt es nie zu solchen Momenten; Karrieren entfalten sich innerhalb der stabilen "normalen Wissenschaft". Aber an den Rändern - in Krisen - werden die Grenzen der Wissenschaft sichtbar. Dort spüre ich, wie meine Faszination neu entfacht wird. An den Rändern liegt eine Einladung, anders zu träumen, die Realität an ihren Wurzeln zu packen. Einst schien mir die Physik ein solches Privileg zu versprechen, doch in der Praxis wird dieses Versprechen von der Hingabe an den "normalen Weg" aufgezehrt.
Für uns Zeitgenossen bestätigt ein blinder Fleck in Kuhns Schrift seine These fast perfekt: Er spricht von "dem Wissenschaftler", als ob Frauen - oder irgendjemand außerhalb dieses Pronomens - nicht existierten. Damals blieb dieser Gebrauch unbemerkt; heute springt er als bezeichnender Anachronismus ins Auge. Sogar Kuhns Prosa hat ihren eigenen Paradigmenwechsel vollzogen: Einst transparent, jetzt problematisch - eine Erinnerung daran, dass das "Normale" immer den stillen Revolutionen der Geschichte unterworfen ist.
Heute hat man fast den Eindruck, dass Kuhn sich vor solcher Kritik geschützt hat, indem er die Paradigmen auf die Naturwissenschaften beschränkte, wo der Begriff eine präzisere Bedeutung hat. Er erkannte das Potenzial der Paradigmen in anderen Bereichen an, hielt seinen Fokus aber eng. Während der Lektüre von Structure habe ich jedoch instinktiv seine Erkenntnisse in anderen Bereichen getestet. Und wohin sollte ich mich wenden, wenn nicht in den Bereich, in dem ich, nachdem ich die Physik beiseite gelegt hatte, eine intellektuelle und spirituelle Heimat fand: das Kino.
Gibt es nicht auch im Kino Paradigmen - jene stillschweigenden Rahmen, durch die wir geschult sind, Werke zu sehen, zu interpretieren und als "Kunst" oder "Unterhaltung" zu deklarieren? Inwieweit ist es Zufall oder Notwendigkeit, dass Ästhetik so eng mit Ideologie und politischem Diskurs verbunden ist? Und könnte es nicht eine andere Art des Sehens geben, die weniger an das "Normale" gebunden ist und der Kunst die Kraft zurückgibt, zu verunsichern, zu erhellen, ja zu verklären?
Jeder, der eine tiefgreifende ästhetische Erfahrung gemacht hat, weiß, wie fremd sich die Welt danach anfühlen kann. Die Wirklichkeit mit den Augen der großen Meister des Kinos zu sehen, bedeutet nicht nur, in neue Welten einzutreten, sondern auch, das Alltägliche zu verändern. Nach Yasujiro Ozu scheint das zwanglose Gespräch über das Familienleben von der stillen, melancholischen Zärtlichkeit des japanischen Regisseurs durchdrungen zu sein. Das Sonnenlicht, das durch die Schatten der Blätter auf einen grünlichen Bach fällt, trägt mich in Apichatpong Weerasethakuls feuchte, traumhafte Pastoralfilme. Und wenn ich das Leben durch die gebetsartige Linse von Terrence Malick betrachte, spüre ich das Heilige, das unter der Oberfläche der Dinge schimmert.
Auch Nicht-Kinofans nehmen die Realität durch eine filmische Linse wahr, die von Erinnerungen und Vorstellungen geprägt ist. Ein Ausflug zum Grand Canyon kann Phantom-Cowboys heraufbeschwören; das Manöver eines Politikers kann als Kapitulation vor der "dunklen Seite der Macht" registriert werden. Jenseits solcher Echos bevölkern filmische Fragmente unsere Tagträume - Gesten, Stimmungen und flüchtige Bilder, die prägen, wie wir die Welt sehen.
Auch wenn sich der künstlerische Fortschritt von der Wissenschaft unterscheidet, eröffnen ästhetische Entdeckungen neue Welten wie Kuhns Paradigmen. Wir können weder zu einem geozentrischen Kosmos zurückkehren noch außer Acht lassen, wie da Vinci die menschliche Gestalt darstellte. Bestimmte Sichtweisen schlummern so lange, bis sie von einer authentischen Stimme geweckt werden. Trotz aller Klagen über das heutige Leben ist ein Grund, warum ich niemals in der Vergangenheit leben möchte, die simple Unverfügbarkeit einiger dieser Perspektiven. Ein Besuch in Eden ohne Weerasethakul ist so, als besäße man den modernsten Teilchenbeschleuniger und hätte dennoch keinen Zugang zum Standardmodell.
Heute spielen sogar Kinder mit Modellen des Sonnensystems und halten es für selbstverständlich, dass wir einen brennenden Stern umkreisen. Aber was für eine Reise war das - und wie seltsam schwierig es doch bleibt, sich die Welt anders vorzustellen. Abgesehen von den offensichtlichen astronomischen Beispielen fand ich Kuhns Darstellung des Periodensystems besonders fesselnd. Man denke nur an die ungeheure Vielfalt der Dinge - lebendig und tot, heiß und kalt, flüssig und gasförmig, brennend oder gefroren, Millionen von Strukturen -, die als elementare Bausteine mit den Nummern 1 bis 118 wahrgenommen werden.
Es sind diese Höhenflüge der Vorstellungskraft, die das Vergnügen an der Lektüre von Structure lebendig werden lassen. Von der ersten Seite an wird klar, dass es sich um ein Werk der Leidenschaft handelt, geboren aus dem tiefen Wunsch, in die Funktionsweise der Wissenschaft einzutauchen - nicht nur in eine Ecke, sondern in das Ganze. Dieses Streben verleiht dem Buch ein seltenes Gefühl der intellektuellen Ermächtigung, als ob verborgene Weisheiten weitergegeben würden, die die Welt reicher und das Verständnis tiefer machen. Es ist keine leichte Lektüre, aber auch nicht undurchdringlich. Entscheidend ist, dass es authentisch ist: keine verwässerte Version für das "allgemeine Publikum", sondern ein Denker, der jeden, der nur will, in das Herz seiner Vision einlädt.
Heute hat die Physik etwas von dem öffentlichen Glanz verloren, den sie zu Kuhns Zeiten noch genoss. In allen Wissenschaften gibt es immer wieder Durchbrüche, aber nur wenige dringen in das allgemeine Bewusstsein ein und zwingen uns, die Welt anders zu sehen. Im Nachhinein hat man fast den Eindruck, dass Kuhn zu einem Zeitpunkt schrieb, als die Sichtbarkeit der Wissenschaft ihren Höhepunkt erreicht hatte.
Aber losgelöst von der strengen naturwissenschaftlichen Verankerung erscheint Kuhns Darstellung des seismischen Wandels aktueller denn je. Ist die Welt nach dem Internet, den Smartphones oder den großen Sprachmodellen wirklich noch dieselbe? Nicht nur metaphorisch, sondern in jeder sinnvollen Hinsicht? Hat "Wissen" nach GPT ein anderes Gewicht? Verändert sich das "Verstehen", wenn Maschinen eine Art des Denkens teilen, die einst ausschließlich menschlich war? Wie wissenschaftliche Revolutionen kumulieren sich diese technologischen Veränderungen nicht Schritt für Schritt, sondern sie brechen die Welt plötzlich auf. Und so wie Kuhn feststellte, dass Experten, die sich dem herrschenden Paradigma verweigerten, nicht mehr als Wissenschaftler anerkannt wurden, so riskieren auch diejenigen, die sich von diesen Technologien abwenden, ihre Teilnahme am zeitgenössischen Leben zu verlieren.
Und doch ist es so, als würde man das Rad hassen, wenn man KI hasst. Obwohl ich noch nie viel von Computern gehalten habe, werde ich das Gefühl nicht los, dass diese Revolution mit der Wirkung von Galileo mithalten oder sie sogar übertreffen könnte. In ihrem Gefolge werden sich viele Menschen auf tragische Weise wie langsame, fehleranfällige Maschinen mit begrenztem Speicher fühlen - eine stille Demütigung, die in das tägliche Leben eingewoben ist. In einer solchen Phase kann jedwede intellektuelle Tätigkeit wie eine endlose, redundante Neuabmischung unserer Wissens- und Kunstarchive erscheinen.
Ich bin kein Wissenschaftshistoriker, und Kuhns Spuren zu verfolgen, um moderne Technologie zu bewerten, übersteigt meine Kompetenz. Meine Faszination liegt woanders: in der Sympathie für eine strahlende Leidenschaft, in großem Maßstab zu verstehen und den modernen "normalen Wegen" der Fragmentierung des Wissens zu widerstehen. Dieser Ehrgeiz, in großen Dimensionen zu denken und kohärente Systeme zu schaffen, ist das, was ich mit der amerikanischen intellektuellen Kultur des späteren 20. Jahrhunderts verbinde - neben Kuhn denke ich an Jared Diamond, Douglas Hofstadter, Marshall McLuhan, Susan Sontag, Noam Chomsky und andere. Jedes Werk ist geprägt von ekstatischer intellektueller Ermächtigung, von Blicken hinter den Schleier der Komplexität, die tiefe Einsichten freilegen, auch wenn sie uns mit den Grenzen unseres Verständnisses konfrontieren.
Ja, unsere Paradigmen mögen für immer formen und einschränken, was wir sehen können, und den Zugang zu absoluten Dingen versperren. Doch indem er das weite Gebiet unserer Grenzen erkundete, eröffnete Kuhn auch neue Welten. Er erinnert uns daran, dass kein Paradigma das letzte Wort auf unserer Entdeckungsreise sein kann, und er tut dies mit großer Leidenschaft, Neugierde und Integrität. Vielleicht ist es genau diese Möglichkeit der radikalen Selbstreflexion, die mich glauben lässt, dass wir auch aus der gegenwärtigen Entfremdung durch die künstliche Intelligenz mit einem tieferen Verständnis - und der Liebe - dessen, was wir wirklich sind, hervorgehen werden.
Als ich mich für einen Beruf entschied, fürchtete ich mich vor den Beschränkungen eines einzelnen Bereichs. Doch vielleicht werden gerade innerhalb unserer Begrenzungen die wichtigsten Dinge sichtbar - und es entsteht die Möglichkeit der Transzendenz. Und das ist nichts, was wir jemals delegieren könnten.
Ja, wir sehen immer nur durch Paradigmen. Hell und klar.
Hat Ihnen dieser Text gefallen? Dann unterstützen Sie doch bitte unsere Arbeit einmalig oder monatlich über eins unserer Abonnements. Wir würden uns freuen!
Wollen Sie keinen Text mehr auf Literatur.Review verpassen? Dann melden Sie sich kostenlos für unseren Newsletter an!



